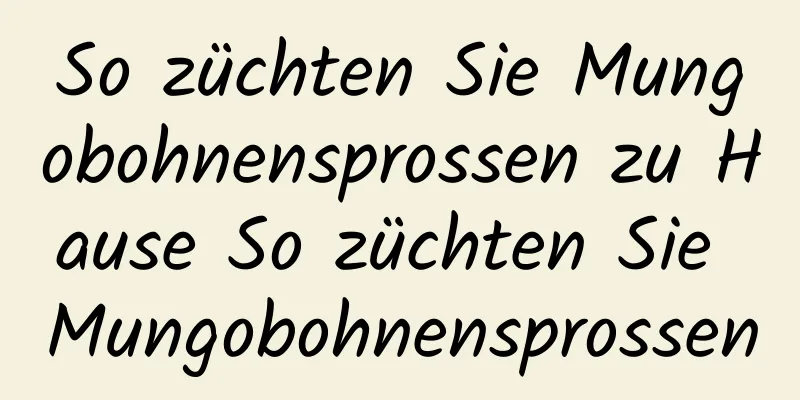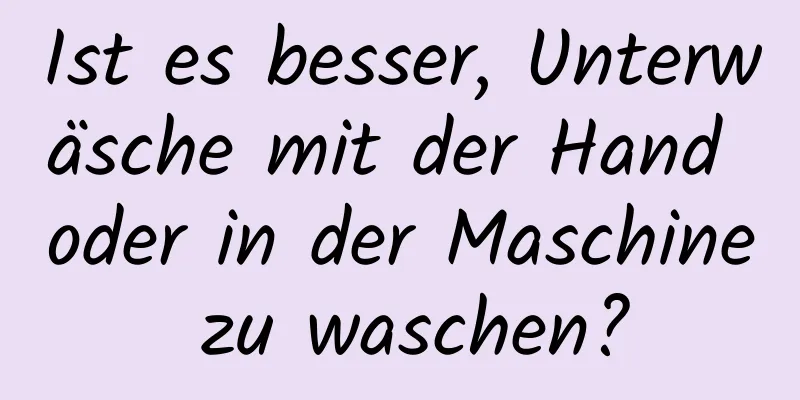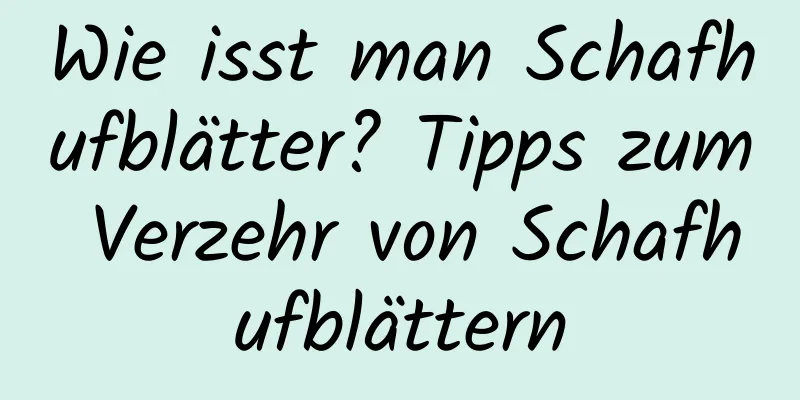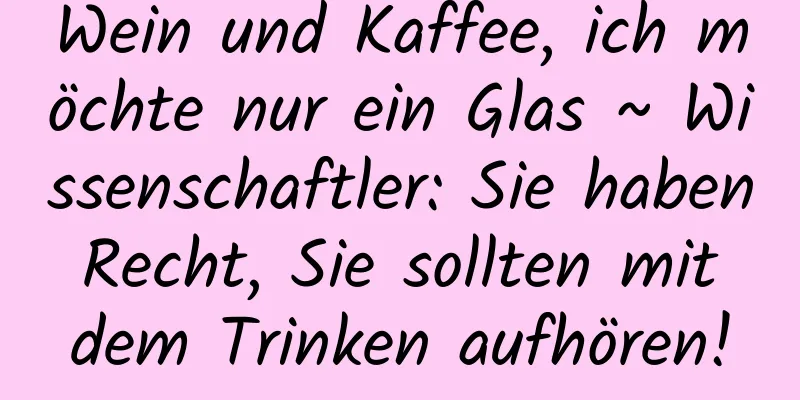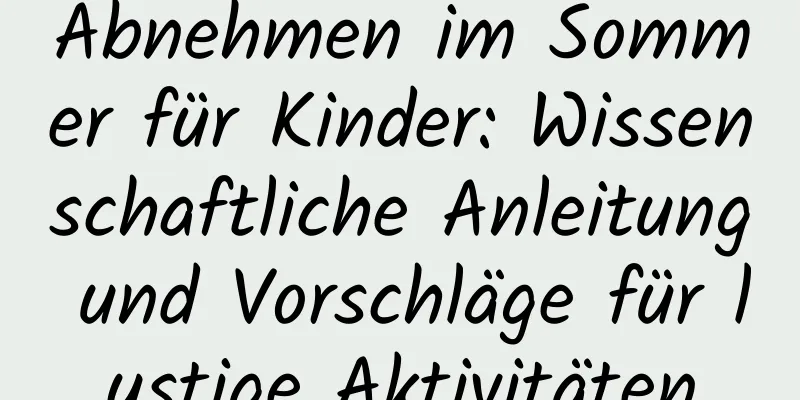Schützen Sie Ihr Gehör und vermeiden Sie berufsbedingten Hörverlust durch Lärm.

|
Bei berufsbedingtem Lärmschwerhörigkeit (Lärmschwerhörigkeit) handelt es sich um einen durch Lärm verursachten sensorischen Hörverlust. Lärm ist im Arbeitsprozess und in der Arbeitsumgebung der Menschen weit verbreitet und Lärmschwerhörigkeit ist eine der häufigsten Berufskrankheiten. Charakteristisch für einen durch Lärm verursachten Hörverlust ist, dass es im Frühstadium zu einer Abnahme des Hörvermögens im Hochfrequenzbereich von 3.000 Hz bis 6.000 Hz kommt und die Gewebezellen an der Basis der Cochlea beschädigt, degeneriert und nekrotisch sind. Mit zunehmender Dauer der Lärmbelastung verschlechtert sich der Zustand und entwickelt sich in Richtung des Sprachfrequenzbands von 500, 1000 und 2000 Hz, was schließlich zu einer Schädigung der gesamten oder eines Großteils der Cochlea führt. Insbesondere bei einer Schädigung der oberen Hörzone treten deutliche Sprachhörstörungen auf. Lärm ist heute in vielen Ländern der Welt eine der größten Gefahren und Lärmbelästigung gilt als die erste der sieben größten Gefahren für die Bevölkerung weltweit. Ursachen 1. Lärmintensität: Die Lärmintensität ist der Hauptfaktor, der das Gehör beeinflusst. Je höher die Intensität, desto früher tritt der Hörverlust auf, desto schwerwiegender sind die Schäden und desto mehr Menschen sind betroffen. 2. Dauer der Lärmbelastung: Lärm unter 80 dB (A) verursacht bei lebenslanger Belastung keine Gehörschäden. Ab 85 dB(A) nehmen die Hörschäden mit der Anzahl der Jahre der Belastung zu. In der Tabelle sind auch die kritischen Belastungsjahre für Hörschäden bei unterschiedlichen Lärmintensitäten aufgeführt, also die Belastungsjahre, in denen der Anteil der Menschen mit Hörschäden 5 % übersteigt. Bei 85 dB(A) beträgt sie 20 Jahre, bei 90 dB(A) 10 Jahre, bei 95 dB(A) 5 Jahre und ab 100 dB(A) innerhalb von 5 Jahren. Die Zeitspanne, die erforderlich ist, um bei hohen Intensitäten einen Hörschaden zu verursachen, ist sehr unterschiedlich und reicht von wenigen Tagen bis zu mehreren Jahren. Im Allgemeinen beträgt sie jedoch etwa 3 bis 4 Monate. 3. Frequenz und Spektrum des Lärms: Das menschliche Ohr ist gegenüber niedrigen Frequenzen toleranter als gegenüber mittleren und hohen Frequenzen. Bei Tönen zwischen 2000 und 4000 Hz ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass sie eine Schädigung der Cochlea verursachen. Schmalbandtöne oder reine Töne haben dabei eine größere Auswirkung als Breitbandtöne. Darüber hinaus ist intermittierender Lärm weniger schädlich als kontinuierlicher Lärm, plötzlicher Lärm ist schädlicher als allmählicher Lärm und von Vibrationen begleiteter Lärm ist für das Innenohr schädlicher als einfacher Lärm. 4. Individuelle Unterschiede: Menschen sind unterschiedlich empfindlich gegenüber Lärm. Etwa 5 % der Bevölkerung sind lärmempfindlich. Bei ihnen ist nach Lärmbelastung nicht nur eine deutlichere vorübergehende Hörschwellenverschiebung (TTS) festzustellen als beim Durchschnittsmenschen, sie erholen sich auch langsamer. Tiere mit unterschiedlichen genetischen Typen sind unterschiedlich anfällig für Lärmschäden. Peter J. Kazel untersuchte das Gen für die Zellmembran-ATPase-Isoform 2 (PMCA2) der Maus und fand heraus, dass homozygote Mäuse mit Mutationen in diesem Gen anfälliger für lärmbedingten Hörverlust waren. Bei mutierten PMCA2-Mäusen kommt es nach übermäßiger Lärmstimulation zu einer deutlichen, dauerhaften Verschiebung der Hörschwelle der Hirnstammreaktionen. Darüber hinaus zeigten Mäuse mit Knockout des Superoxiddismutase-Gens einen stärkeren Hörverlust16. Peter M. Rabinowits et al. untersuchten den Polymorphismus zweier Stoffwechselgene (GSTM1 und GSTT1), die mit der Glutathion-S-Konvertase in Zusammenhang stehen, bei 58 Arbeitern und fanden heraus, dass Arbeiter mit dem GSTM1-Gen eine höhere Frequenz otoakustischer Emissionen von Verzerrungsprodukten aufwiesen, was auf Veränderungen in der Funktion der äußeren Haarzellen hindeutet. Dies lässt darauf schließen, dass dieses Gen eine wichtige Rolle beim Schutz der Zellen vor Lärmschäden spielen könnte. 5. Lärmart und Belastungsmodus: Impulslärm ist schädlicher als Dauerlärm, und die Dauer ist schädlicher als indirekter Kontakt. 6. Andere Faktoren: wie z. B. Alter. Je älter Sie sind, desto schwerwiegender sind die Lärmschäden. Faktoren für Ohrenerkrankungen: Menschen mit sensorineuralem Hörverlust neigen zu lärmbedingtem Hörverlust. Gleichzeitig geht man davon aus, dass sich ein erkranktes Hörorgan nach einer Verletzung schwieriger erholt als ein normales. Über die Auswirkungen von Lärmstimulation auf Patienten mit Mittelohrentzündung gehen die Meinungen weiterhin auseinander. Darüber hinaus hängen die Geschwindigkeit des Auftretens und der Schweregrad eines lärmbedingten Hörverlusts eng mit dem persönlichen Schutz zusammen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum in einer Umgebung mit hoher Lautstärke Gehörschutz und Ohrstöpsel tragen, verläuft die Entstehung und Entwicklung von Hörschäden langsam und mild. Durch den Einsatz von Schallschutz-, Schallschutz- und Schallabsorptionseinrichtungen am Arbeitsplatz können die Auswirkungen von Lärm verringert werden. Pathophysiologie Früher ging man davon aus, dass mechanische Vibrationen die Hauptursache für lärmbedingte Innenohrschäden seien. Neuere Studien haben ergeben, dass viele Faktoren am lärmbedingten Zelltod im Innenohr beteiligt sind, beispielsweise Veränderungen des Redoxzustands der Innenohrzellen, die übermäßige Produktion freier Radikale und ein Ungleichgewicht des Kalziumhaushalts. Das durch Lärm verursachte Absterben der Haarzellen im Innenohr kann teilweise reduziert werden, indem freie Radikale entfernt, die Durchblutung des Innenohrs verbessert, das intrazelluläre Kalziumionengleichgewicht wiederhergestellt und die exzitotoxische Neurotoxizität von Glutamat verringert wird, was sich positiv auf die Genesung von lärmbedingtem Hörverlust auswirkt. Die durch Lärm verursachten Schäden an den Hörorganen sind die Grundlage für Lärmschwerhörigkeit, insbesondere für die Entstehung eines posttraumatischen Hörverlusts. Daten aus Humanstudien und zahlreichen Tierversuchen haben gezeigt, dass unabhängig von der Art der Geräuschstimulation, der die Haarzellen ausgesetzt sind (Breitbandgeräusche, Schmalbandgeräusche, Geräusche mit hoher oder niedriger Frequenz, reiner Ton usw.), die Schädigung der Haarzellen im Corti-Organ überwiegend in der Basalwindung und der zweiten Windung der Basilarmembran der Cochlea auftritt. Aus der Perspektive des Prozesses der Haarzellschädigung kommt es zunächst zur Degeneration und zum Verlust der äußeren Haarzellen und dann zur Degeneration der Synapsen zwischen Haarzellen und Hörnervenfasern. Ihre Anzahl und morphologische Struktur ändern sich, was sich hauptsächlich wie folgt äußert: 1. Abnahme der aufsteigenden Synapsen; 2 eine Abnahme der Vesikel in Synapsen; ③ eine Abnahme des synaptischen Volumens; ④ eine Abnahme der Akkumulationsdichte von Vesikeln in Synapsen. In drei Reihen äußerer Haarzellen. Die dritte Reihe ist am anfälligsten für Schäden, da sie sich in der Mitte der Basalmembran befindet. Der Schwingweg ist der größte und daher am anfälligsten für Beschädigungen. Bei zunehmender Lärmbelastung werden Stützzellen wie die zweite Haarzellenreihe, Deiter-Zellen, Heine-Zellen und äußere Säulen beeinträchtigt. Da sich die inneren Haarzellen nahe der knöchernen Spiralplatte befinden, ist ihre Auslenkungsamplitude bei Vibrationen gering. Der Schaden ist also relativ gering. Die Lärmschwelle, ab der es zu Schäden kommt, liegt etwa 20 dBA höher als die des externen Kapillarlärms. Wenn eine Beteiligung innerer Haarzellen vorliegt. Dies geht häufig mit einer Abnahme der Anzahl der Spiralganglienfasern und ihrer Zellen bis hin zur Deformation, Zerstörung und zum Verschwinden des gesamten Corti-Organs einher. Der durch Lärm verursachte Verlust von Haarzellen in der Cochlea kann zur Degeneration der Hörnervenfasern führen. Eine Degeneration des Spiralganglions kann zu einer Volumenverringerung des Nucleus cochlearis, zur Apoptose von Zellen und zu einer Verringerung der Zellzahl führen. Nach der Untersuchung der Cochlea auf einer Seite, auf der das gesamte Corti-Organ beschädigt war, stellte man fest, dass der Grad des Verlusts des Hörnervs in verschiedenen Teilen unterschiedlich war: 82 % im mittleren und unteren Teil, 67 % im mittleren Teil und 49 % im oberen und mittleren Teil. Die durch Lärm verursachten Schäden im Hörzentrum des zentralen Hörsystems treten hauptsächlich im Nucleus cochlearis, im Nucleus olivare superior, im Corpus geniculatum medialis, im Hypothalamus und im auditorischen Kortex auf. Lärm kann in diesen Bereichen eine neuronale Degeneration, Veränderungen der elektrophysiologischen Zellaktivität und eine Rekonstruktion der Frequenzabstimmungskurven verursachen, was zu einer Verschlechterung der Spracherkennung und der Fähigkeit zur Integration von Tonsignalen führt. Wenn der Reiz über der charakteristischen Frequenz liegt. Und wenn das Neuron einen hemmenden Bereich außerhalb des erregenden Bereichs hat, dehnt sich der Niederfrequenzbereich am Ende der Kurve aus, und manchmal dehnt sich auch der Hochfrequenzbereich aus, was zu einem leichten bis mittelschweren Hochfrequenz-Hörverlust führt. Die charakteristische Frequenz nimmt in primären auditorischen Kortexneuronen signifikant ab und ändert sich im präauditiven Bereich und im sekundären auditorischen Kortex kaum. Die durchschnittliche Frequenzkurvenbreite nahm im sekundären auditorischen Kortex signifikant ab. Die spontane elektrische Aktivität war im primären auditorischen Kortex erhöht, im vorauditorischen Bereich unverändert und im sekundären auditorischen Kortex verringert. Diese Neugestaltung der kortikalen Frequenzverteilungskarte kann durch Änderungen in der subkortikalen Frequenzverteilungskarte verursacht werden. Pathogener Mechanismus 1. Theorie der mechanischen Verletzung: Man geht davon aus, dass die Schädigung des Hörorgans durch die mechanische Einwirkung von Schallwellen verursacht wird. Dabei werden hauptsächlich die folgenden Gesichtspunkte berücksichtigt: 1. Wenn hochintensiver Lärm durch die Gehörknöchelchenkette oder das Cochlea-Fenster übertragen wird, kann es zu einem starken Fluss von Endolymphe und Perilymphe kommen, wodurch ein Wirbel entsteht. Der starke Flüssigkeitswirbel wirkt auf den Cochlea-Gang, wodurch die Vestibularismembran reißen kann, was zur Vermischung der Endolitholymphe und zu Veränderungen der Ionenzusammensetzung sowie zu Schäden an den Spiralorganzellen führt, gefolgt von einer Atrophie der Stria vascularis und einer Degeneration der Nervenfasern; 2. Starke Vibrationen der Basilarmembran können die Vestibularismembran reißen, was zur Vermischung der Endolitholymphe und zu Veränderungen der Ionenzusammensetzung sowie zu Schäden an den Spiralorganzellen führt, gefolgt von einer Atrophie der Stria vascularis und einer Degeneration der Nervenfasern. 3. Starke Vibrationen der Basilarmembran verursachen Mikroporen in der retikulären Schicht, wodurch Endolymphe um die Haarzellen herum eindringt und zu einem Überschuss an Kaliumionen in der inneren Umgebung führt. Dadurch wird die Zellmembran der Haarzellen der Umgebung mit einem abnormal hohen Kaliumgehalt ausgesetzt und dadurch beschädigt. ④ Das Spiralorgan ist von der Basilarmembran getrennt; ⑤ Die Tektorialmembran ist von den Haarzellen getrennt. 2. Gefäßtheorie: Lärmbelastung kann die Mikrozirkulation in der Cochlea schädigen, was zu Ischämie und Hypoxie der Cochlea und zur Degeneration von Haarzellen und Spiralorganen führen kann. Zahlreiche Tierversuche haben gezeigt, dass bei der Stimulation durch starken Lärm eine Reihe von Veränderungen in den Blutgefäßen der Cochlea auftreten können, die Vasospasmen, Kontraktionen oder Dilatationen, einen langsameren Blutfluss und eine verringerte lokale Durchblutung verursachen können. Schwellung des Gefäßendothels, erhöhte Durchlässigkeit und Blutkonzentration, was zu einer deutlichen Erhöhung der Viskosität führt; Thrombozyten- und Erythrozytenaggregation sowie Thrombose; Dies führt zu Mikrozirkulationsstörungen, verminderter Durchblutung der Cochlea, unzureichender Blutversorgung des Innenohrs und vermindertem Sauerstoffgehalt in der inneren und äußeren Lymphe. Die oben genannten Gefäßveränderungen verursachen lokale Ischämie und Hypoxie, was zu Stoffwechselstörungen im Cochlea-Umfeld, einem verringerten Haarzellstoffwechsel, Störungen der Energiespeicherung und -versorgung sowie Funktionsstörungen des Enzymsystems führt, was wiederum zu einer Reihe pathophysiologischer Veränderungen führt, wie etwa einer Schädigung der morphologischen Struktur der Haarzellen einschließlich des Spiralorgans und Funktionsstörungen der Umwandlung von Schall in Elektrizität. Mithilfe der Wasserstoff-Clearance-Methode bzw. der Laser-Doppler-Blutflussmessung wurde festgestellt, dass hoch- und mittelfrequente reine Töne oder Geräusche zu einer Verringerung des Cochlea-Blutflusses führen können. Lichtmikroskopische Untersuchungen legten nahe, dass der Grad der mikrovaskulären Veränderungen mit einer Schädigung der Haarzellen zusammenhängt. 3. Stoffwechseltheorie: Lärm kann zu schwerwiegenden Störungen der Enzymsysteme von Haar- und Stützzellen führen, die zu Störungen des Sauerstoff- und Energiestoffwechsels, zur Zelldegeneration und zum Zelltod führen. Eine kontinuierliche Lärmstimulation beeinflusst die Haarzellen der Cochlea, erhöht deren Bedarf an Adenosintriphosphat und steigert den Sauerstoff- und Glukoseverbrauch der Haarzellen und Stützzellen. Dies führt zu einer lokalen relativen Ischämie, einem erhöhten Gehalt an freien Radikalen und einer intrazellulären Ca-Überladung, was wiederum zur Nekrose und Apoptose der Zellstruktur führt. Darüber hinaus verstärken der lärmbedingte Abfall des Sauerstoffpartialdrucks in der Cochlea-Lymphe und die Minderversorgung die Auswirkungen auf die Aktivität der Adenosintriphosphatase zusätzlich. Lärm kann außerdem die Blutgefäße direkt schädigen und lokale Mikrozirkulationsstörungen, Gewebeödeme, verminderten Blutsauerstoff und eine verringerte K+-Na+-ATPase-Aktivität in der Stria vascularis verursachen. Dadurch wird die Aufrechterhaltung des Kationenkonzentrationsgradienten in der Endolymphe und des intracochleären Potentials unmöglich, was zu Funktionsstörungen des Cochlea-Organs und der Haarzellen führt. 4. Sonstiges: Neuere Studien haben ergeben, dass die Stickoxid-Synthase II (NOS II) in der lärmgeschädigten Cochlea, insbesondere in der Stria vascularis und den Spiralganglienzellen, positiv exprimiert wird. Tierversuche haben gezeigt, dass es in der lärmexponierten Cochlea zu Zellapoptose kommt, und man kam zu dem Schluss, dass die frühe Zellapoptose im geschädigten Ohr die Hauptursache für Hörverlust ist. Heutzutage sind Gene, die für Lärmschwerhörigkeit anfällig sind, zu einem wichtigen Forschungsschwerpunkt in der akademischen Gemeinschaft geworden. Die meisten aktuellen Forschungsergebnisse zeigen, dass die wichtigsten Suszeptibilitätsgene die folgenden sind: 1 7,4 kb Deletion des mitochondrialen Gens; 2 Presbyakusis-Gen (AHL); 3. Mutation der Plasmamembran-Ca2+-ATPase 2; ④ Superoxiddismutase; ⑤ Glutathion-S-Transferase; ⑥ Cadherin 23 (CDH23); ⑦ Deletion des nukleären Transkriptionsfaktors-KB (NF-KB). Klinische Manifestationen 1. Fortschreitender Hörverlust Wenn Sie zum ersten Mal Lärm ausgesetzt sind, kann Ihr Gehör leicht getrübt sein. Wenn Sie den Lärm verlassen, erholt sich Ihr Gehör nach einigen Minuten. Dieses Phänomen wird als auditive Adaption bezeichnet. Ist das Gehör durch lang anhaltenden und starken Lärm deutlich getrübt, kann es mehrere Stunden dauern, bis sich das Gehör erholt. Dies wird als Hörermüdung bezeichnet. Wenn Sie weiteren Lärmreizen ausgesetzt sind, kann dies zu Hörschäden führen, die sich nur schwer von selbst beheben lassen. 2. Tinnitus Die Erkrankung kann vor der Taubheit auftreten oder sich gleichzeitig mit der Taubheit entwickeln. Es ist hochfrequent, häufiger kommt jedoch das Geräusch von Zikaden vor. Es stört die Menschen oft Tag und Nacht und verschlimmert sich, wenn es ruhig ist. 3. Sonstiges: Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Gedächtnisverlust, langsame Reaktion, Depression, Herzklopfen, Bluthochdruck, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Verdauungsstörungen und andere Symptome können auftreten. Testen 1. Ohrenuntersuchung: Das Trommelfell von Patienten mit lärmbedingter Taubheit kann verstopft sein oder vereinzelte kleine Blutungen aufweisen. Eine explosionsartige Schwerhörigkeit kann eine Perforation des Trommelfells verursachen, während eine Perforation der Pars flaccida selten ist. Bei einem Trommelfellriss kommt es häufig zu Blutungen und die Ränder der Perforation sind uneben, oft dreieckig, oval oder nierenförmig. 2. Hörtest: Der Grad des Hörverlusts variiert je nach Ausmaß der Schädigung, der Hörverlustbereich liegt jedoch hauptsächlich zwischen 3000 und 6000 Hz. Frühes Anzeichen einer Hörschädigung bei 4000 Hz. Die Hörkurve weist eine Talform auf, die sich allmählich vertieft, und auch 2000 Hz und 8000 Hz sind betroffen, sodass das Gehör einen Abwärtshang aufweist. Im Allgemeinen sind die Krümmungen der beiden Ohren symmetrisch. Bei asymmetrischen handelt es sich meist um Ohrenerkrankungen oder Sonderfälle. Das typische audiologische Spektrum eines durch Berufslärm verursachten Hörverlusts ist eine V- oder U-förmige Vertiefung. Mithilfe der Elektrocochlea-Elektrographie und der Hirnstammaudiometrie lässt sich der Ort der Taubheit besser bestimmen und das Ausmaß des Hörverlusts objektiv beurteilen. Bei Patienten mit schweren Explosionsverletzungen kann bei Bedarf eine hochauflösende CT oder MRT durchgeführt werden, um die Läsionen in der Paukenhöhle, dem inneren Gehörgang und dem Schläfenbein zu verstehen. Krankheitsdiagnose Ein lärmbedingter Hörverlust kann diagnostiziert werden, wenn eine eindeutige Vorgeschichte von Lärmbelastung am Arbeitsplatz (normalerweise über 85 Dezibel), bewusstem Hörverlust oder Tinnitussymptomen sowie einem durch Tonaudiometrie festgestellten sensorineuralen Hörverlust vorliegt. Kombiniert mit dynamischen Beobachtungsdaten, Hygieneuntersuchungen vor Ort und Ausschluss anderer Ursachen für Hörverlust. Eine spezifische diagnostische Klassifizierung finden Sie im Arbeitsgesundheitsstandard der Volksrepublik China GBZ49-2007 „Diagnosestandard für berufsbedingte Hörbehinderung“. Liegt bei einem Ohr ein kombinierter Hörverlust vor und entspricht die Knochenleitungshörschwelle den Merkmalen eines durch Berufslärm verursachten Hörverlusts, können Diagnose und Beurteilung auf Grundlage der Knochenleitungshörschwelle dieses Ohrs erfolgen. Wenn die Knochenleitungshörschwelle erhöht ist, kann dies mit einem Schallleitungsschwerhörigkeitsverlust zusammenhängen und die Reintonhörschwelle des kontralateralen Ohrs sollte zur diagnostischen Beurteilung herangezogen werden. Wenn beide Ohren unter einem kombinierten Hörverlust leiden und die Knochenleitungshörschwelle die Merkmale eines durch Berufslärm verursachten Hörverlusts aufweist, können Diagnose und Beurteilung auf Grundlage der Knochenleitungshörschwelle erfolgen. Bei der Diagnose und Beurteilung auf Grundlage der Knochenleitungshörschwellen müssen die Ergebnisse der Knochenleitungs-Reintonaudiometrie gemäß GB/T 7582 auch hinsichtlich Alter und Geschlecht korrigiert werden. Nach der Berechnung der durchschnittlichen Hörschwellen für das linke bzw. rechte Flüstern wird die durchschnittliche Hörschwelle des besseren Ohrs zur Diagnose und Einstufung eines lärmbedingten Hörverlusts verwendet. Wenn der Hörverlust im Sprachbereich größer oder gleich dem Hörverlust im Hochtonbereich ist, sollte kein berufsbedingter Lärmschwerhörigkeit diagnostiziert werden. Wenn die Hörkurve eines Reintonaudiometrietests horizontal oder annähernd gerade ist, sollte die Authentizität des Hörtestergebnisses in Frage gestellt werden. Wenn der Hörverlust im Sprachbereich einen mittelschweren Lärmhörverlust übersteigt, sollte eine objektive audiometrische Untersuchung durchgeführt werden, um eine Pseudoschwerhörigkeit und einen übermäßigen Hörverlust auszuschließen. Zu den weiteren Ursachen für Taubheit, die bei der Diagnose ausgeschlossen werden sollten, zählen vor allem: Pseudotaubheit, übermäßiger Hörverlust, medikamenteninduzierte Taubheit (Streptomycin, Gentamicin, Kanamycin usw.), traumatische Taubheit, Taubheit durch Infektionskrankheiten (Meningokokken-Meningitis, Mumps, Masern usw.), familiäre Taubheit, Morbus Menière, plötzliche Taubheit und verschiedene Mittelohrerkrankungen. Differentialdiagnose 1. Hörverlust durch Mittelohrentzündung Ein Schallleitungsschwerhörigkeitsverlust, der aus verschiedenen Gründen verursacht werden kann, führt zu Unterschieden bei Untersuchungen und Tests der Luftleitung und des Knochenhörvermögens. Das heißt, die Knochenleitung ist normal, während die Luftleitung einen Hörverlust anzeigt. Bei einer zentralen Perforation des Trommelfells und normaler Gehörknöchelchenkette beträgt der Hörverlust 10 bis 30 Dezibel und betrifft vor allem den Niederfrequenzbereich. Trommelfellperforation mit Unterbrechung der Gehörknöchelchenkette: Eine Trommelfellperforation mit Unterbrechung der Gehörknöchelchenkette macht etwa 60 % der Fälle einer chronischen eitrigen Mittelohrentzündung aus und geht mit einem durchschnittlichen Hörverlust von 40 bis 60 Dezibel einher, der vor allem tiefe Frequenzen betrifft. Die Gehörknöchelchenkette ist aufgrund eines Traumas oder aus anderen Gründen unterbrochen, das Trommelfell bleibt jedoch intakt: Der Hörverlust beträgt 40 bis 60 Dezibel und ist durch eine flache Kurve des durchschnittlichen Verlusts gekennzeichnet. Vollständiges Fehlen des Trommelfells und der Gehörknöchelchen: durchschnittlicher Hörverlust 50 Dezibel. Intaktes Trommelfell + unterbrochene Gehörknöchelchenkette + geschlossenes ovales Fenster: Der durchschnittliche Hörverlust durch diese Art von Läsion beträgt 60 Dezibel. Verstopfung des äußeren Gehörgangs: Eine Verstopfung des äußeren Gehörgangs durch Ohrenschmalz kann einen Plattenepithel-Hörverlust von 30 Dezibel verursachen. 2. Hörverlust durch Erkrankungen des Innenohrs und audiologische Merkmale (1) Angeborene Taubheit: Sie kann erblich bedingt oder nicht erblich bedingt sein. es kann einseitig oder beidseitig auftreten, mit unterschiedlich starkem Hörverlust; es ist größtenteils sensorineural. (2) Toxische Taubheit: Im Allgemeinen bezieht sich toxische Taubheit auf einen Hörverlust, der durch die Einnahme bestimmter Medikamente zur Behandlung von Krankheiten oder durch den Kontakt des menschlichen Körpers mit bestimmten Chemikalien verursacht wird. Schäden durch Systemvergiftung. Eine der Hauptursachen für Taubheit ist die medikamenteninduzierte Taubheit. Zu den ototoxischen Medikamenten zählen Aminoglykosid-Antibiotika wie Streptomycin, Gentamicin, Kanamycin, Neomycin, Vancomycin, Krebsmedikamente, Diuretika, Malariamedikamente, Salicylate (Aspirin), Schwermetalle, Ethanol, Kohlenmonoxid, Antiepileptika usw. Es wird allgemein angenommen, dass Veränderungen der Hörfunktion chronisch, verzögert und fortschreitend sind. Symptome wie Taubheit und Tinnitus treten normalerweise 1 bis 2 Wochen nach der Einnahme des Medikaments auf. Bei 30 % treten die Symptome innerhalb eines Monats auf, bei 45 % innerhalb von drei Monaten und die längste Zeitspanne bis zur Entstehung einer Taubheit beträgt etwa ein Jahr. Merkmale des Hörverlusts: Der Hörverlust in beiden Ohren ist symmetrisch, beginnt bei den hohen Frequenzen, verschlechtert sich allmählich und hört nach etwa einem halben Jahr auf. Bei anfälligen Personen kommt es zu einem starken Hörverlust bis hin zur Schwerhörigkeit oder sogar zur völligen Taubheit. Der Grad der Taubheit ist nicht proportional zur Medikamentenmenge. (3) Infektiöse Taubheit: Infektionen durch zahlreiche pathogene Mikroorganismen wie Viren, Bakterien, Pilze, Chlamydien und Mykoplasmen können direkt oder indirekt zu Schäden am Innenohr führen, die zu unterschiedlich starker sensorineuraler Taubheit oder vestibulärer Dysfunktion in einem oder beiden Ohren führen, was als infektiöse Taubheit bezeichnet wird. Zu den Erregern, die nachweislich eine infektiöse Schwerhörigkeit verursachen, zählen unter anderem Röteln, Mumps, Masern, Gürtelrose, epidemische Meningitis, epidemische Enzephalitis B, Syphilis usw. (4) Presbyakusis: Die Häufigkeit der Presbyakusis ist individuell sehr unterschiedlich, und auch die Geschwindigkeit ihrer Entwicklung ist individuell unterschiedlich. Die allgemeinen Erscheinungsformen sind: Bei Patienten mittleren und höheren Alters liegen keine anderen Faktoren vor, die die Taubheit verursachen, die Ursache ist unbekannt und es kommt zu einer Abnahme des beidseitigen Hochfrequenzgehörs. Bei manchen Personen kann es zunächst zu einseitiger Taubheit kommen und dann allmählich zu beidseitiger Taubheit. Der Hörverlust schreitet langsam und allmählich voran. Hörverlust äußert sich als Sprachhörverlust, der schwerwiegender ist als ein Tonschwerhörigkeitsverlust und mit Verständnisschwierigkeiten und einer deutlichen Verringerung der Sprachunterscheidung einhergeht. Es kommt zu einem Reexzitationsphänomen: Das heißt, man kann leise Stimmen nicht hören, empfindet laute Stimmen jedoch als zu laut und die Reichweite des Hörfelds ist eingeschränkt. Audiologische Untersuchung: Die Reintonaudiometrie zeigt eine gleichmäßige Verringerung des Hörverlusts durch Luft-Knochenleitung und die Hörkurve ist meist hochfrequent abnehmend oder steil ansteigend. Mit zunehmendem Alter steigt die Hörschwelle langsam und mit geringen Schwankungen an. Es kommt zu einem deutlichen Rückgang der Sprachaudiometrie, und die Spracherkennungsrate nimmt nicht parallel zu den Veränderungen des Tongehörs ab. Aufgrund der Degeneration der Funktion des Hörzentrums nimmt die Fähigkeit zum Sprachverständnis ab, was zu dem Phänomen führt, dass man nur den Laut hört, aber die Bedeutung nicht versteht. Viele wurden wiederbelebt. (5) Plötzliche Taubheit: Unter plötzlicher Taubheit versteht man eine sensorineurale Taubheit unbekannter Ursache. Das Erkrankungsalter liegt meist zwischen 30 und 60 Jahren. Das Verhältnis von Männern zu Frauen beträgt 1:1 bis 2:1. Plötzliche Taubheit ist meist einseitig und der Hörverlust sinkt normalerweise innerhalb von Minuten oder Stunden auf den niedrigsten Punkt. (6) Nichtorganische Taubheit (nichtorganische Schwerhörigkeit) Bei klinischen und arbeitsmedizinischen Untersuchungen stellt man häufig fest, dass die Ergebnisse der Reintonprüfung nicht mit dem tatsächlichen Hörverlust übereinstimmen. Einige der Probanden übertrieben das Ausmaß ihres Hörverlusts absichtlich. Diese Art von Situation wird oft als „anorganisches Hören“, Pseudohypakusis, geistiger oder hysterischer und psychogener Hörverlust beschrieben. Pseudoschwerhörigkeit, heute als „übertriebener Hörverlust“ bezeichnet, ist ein häufiges Problem bei Höruntersuchungen im Rahmen gesetzlicher Entschädigungen und Berufskrankheitsentschädigungen, insbesondere bei der Diagnose von berufsbedingtem Hörverlust. Krankheitsbehandlung Gegen lärmbedingten Hörverlust gibt es derzeit keine wirksame Behandlung. Bei Auftreten von Symptomen sollten Sie die laute Umgebung rechtzeitig verlassen, Lärmreize unterbinden und die natürliche Genesung fördern. Gleichzeitig sollte auf eine frühzeitige Behandlung Wert gelegt werden. Zu den gängigen therapeutischen Medikamenten zählen: Medikamente, die die Neurotrophie regulieren, wie etwa Vitamin-B-Medikamente; Vasodilatatoren wie Puerarin, 654-2, Salvia Miltiorrhiza, Ginkgo Biloba, Angelika-Injektion und andere Medikamente; biologische Produkte, die den Stoffwechsel fördern, wie Coenzym A usw. Tinnitus und Schwindel können symptomatisch behandelt werden. Akupunktur, Physiotherapie, Akupressur und andere Methoden können die Symptome lindern. Menschen mit starkem Hörverlust können Hörgeräte tragen. Krankheitsprognose: Berufsbedingter Lärmschwerhörigkeit ist im Allgemeinen unheilbar und mit zunehmendem Alter kann es vorzeitig zu einem Hörverlust kommen. Manche Menschen leiden möglicherweise an Persönlichkeitsstörungen und anderen psychischen Störungen. Krankheitsvorbeugung: Die durch Produktionslärm verursachten Gehörschäden bei Arbeitnehmern sind oft das Ergebnis einer langfristigen, langsamen Akkumulation und können leicht übersehen werden. Da es sich bei berufsbedingtem Lärmschwerhörigkeit um einen irreversiblen dauerhaften Hörverlust handelt, der nur verhindert, aber nicht geheilt werden kann, ist es besonders wichtig, ihn zu verhindern, bevor er eintritt. Der erste Schritt besteht darin, die Lärmquelle zu kontrollieren. Es können geräuscharme Produktionsanlagen ausgewählt und Produktionsprozesse verbessert werden oder die Bewegungsart der Lärmquelle verändert werden (z. B. durch Dämpfung, Schwingungsisolierung und andere Maßnahmen zur Reduzierung der Vibration fester Schallkörper). Zweitens: Blockieren Sie die Ausbreitung von Lärm, beispielsweise durch Schallabsorption, Schalldämmung, Schallschutzwände, Schwingungsisolierung und andere Maßnahmen zur Kontrolle der Lärmausbreitung. Drittens müssen persönliche Schutzmaßnahmen ergriffen werden. wie zum Beispiel das Tragen eines Gehörschutzes. Zum Gehörschutz zählen vor allem Ohrstöpsel und Kapselgehörschützer. Derzeit sind Ohrstöpsel aus Schaumstoff mit langsamer Rückstellkraft im Ausland beliebter. Dieser Ohrstöpseltyp bietet die Vorteile eines hohen Schalldämmwerts sowie hohen Tragekomfort und einer einfachen Handhabung. Für Arbeitnehmer, die lärmbelasteten Arbeiten ausgesetzt sind, ist eine jährliche arbeitsmedizinische Untersuchung inklusive Hörtest besonders wichtig. Wenn Hörstörungen festgestellt werden, die die nationalen Standards erreichen, sollten die Betroffenen zeitnah von der Lärmbelastung ferngehalten werden. Wenn die folgenden Situationen eintreten, kann es bei Ihnen zu Hörverlust kommen. Es wird empfohlen, so schnell wie möglich einen Arzt aufzusuchen und die laute Umgebung so schnell wie möglich zu verlassen. (1) Sie müssen am Arbeitsplatz laut sprechen. (2) Wenn Sie zu Hause fernsehen, müssen Sie die Lautstärke erhöhen. (3) Ihre Familienmitglieder beschweren sich oft über Ihre laute Stimme. (4) Sie haben in einer lauten Umgebung Schwierigkeiten, zu hören, was andere sagen. (5) Häufiges Tinnitus, beispielsweise das Zirpen von Zikaden, insbesondere in einer ruhigen Umgebung. Die folgenden zwei Arbeitnehmergruppen sind für laute Arbeiten nicht geeignet: (1) Arbeitnehmer, die bereits bei ärztlichen Untersuchungen vor Arbeitsbeginn einen Hörverlust erlitten haben, sollten zum Schutz ihrer Gesundheit und Sicherheit keine lauten Arbeiten mehr verrichten. (2) Lärmempfindliche Arbeitnehmer: Bei lärmempfindlichen Arbeitnehmern kommt es nach Lärmbelastung zu Reizbarkeit, Schlafstörungen und Tinnitus. Nach kurzer Lärmbelastung und einem Hörtest wird eine Verschlechterung des Hochtongehörs festgestellt. Wenn die durchschnittliche Hochfrequenzhörschwelle beider Ohren größer oder gleich 40 dB ist, sind sie nicht mehr geeignet, weiterhin lärmbedingte Arbeiten auszuführen. Ernährungsvorkehrungen und Krankheitsbehandlung Patienten mit Lärmschwerhörigkeit sollten die laute Umgebung möglichst schnell verlassen und auf eine gesunde Ernährung und Ruhezeiten achten. Wenn der Tinnitus zu Schlafstörungen führt, können zusätzlich Beruhigungsmittel verabreicht werden. Patienten sollten ermutigt werden, sich selbst zu beruhigen, wenn sie durch Lärm verursachte Stimmungsschwankungen wie Depressionen und Angstzustände erleben. Expertenmeinung 1. Definition und Arten von Lärm: Lärm ist eine Art von Geräusch. Physikalisch betrachtet ist Lärm ein unregelmäßiges und chaotisches Gemisch von Schallwellen unterschiedlicher Frequenz und Intensität, das für den Menschen störend und unangenehm klingt. Aus psychologischer Sicht kann jeder Ton, den der Mensch nicht braucht, als Lärm betrachtet werden. Aus Sicht der Audiologie gilt jeder Schall als Lärm, der eine bestimmte Intensität überschreitet und zu einer Schädigung des menschlichen Gehörs führt. Lärm wird in Industrielärm bzw. Produktionslärm, Militärlärm und Umweltlärm unterteilt. Als Produktionslärm oder Industrielärm bezeichnet man den Lärm, der durch den Produktionsprozess entsteht. 2. Was ist der Unterschied zwischen Wohnlärm und Berufslärm? In modernen Städten gibt es vier Hauptquellen für Umgebungslärm: 1. Verkehrslärm, 2. Industrielärm, 3. Baulärm und 4. Lärm des gesellschaftlichen Lebens. Der „Lärmstandard für städtische Gebiete der Volksrepublik China“ legt die Höchstgrenzen für Umgebungslärm in fünf Arten von städtischen Gebieten klar fest: Sanatoriumsgebiete, Luxusvillengebiete und Luxushotelgebiete, 50 dB tagsüber und 40 dB nachts; Bereiche, in denen sich hauptsächlich Wohnhäuser sowie Kultur- und Bildungseinrichtungen befinden, 55 dB tagsüber und 45 dB nachts; gemischte Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete, 60 dB tagsüber und 50 dB nachts. Unter Berufslärm versteht man vor allem Industrielärm, der überwiegend aus dem Lärm von Maschinen oder Betriebsvorgängen besteht. Die nationalen Arbeitsschutzstandards schreiben vor, dass Arbeitnehmer 8 Stunden in einer Lärmumgebung mit 85 Dezibel (dB), 4 Stunden in einer Lärmumgebung mit 88 Dezibel (dB) und 2 Stunden in einer Lärmumgebung mit 91 Dezibel (dB) arbeiten können, wobei der Arbeitspegel entsprechend sinkt. Über 140 Dezibel können Ohrenschmerzen verursachen. Zu den durch Industrielärm verursachten Berufskrankheiten zählen berufsbedingte Lärmschwerhörigkeit und durch Explosionsgeräusche verursachte Schwerhörigkeit. 3. Berufsbedingte Lärmschwerhörigkeit und berufsbedingter Hörverlust Generell kann eine längerfristige Belastung durch Lärm am Arbeitsplatz (die Empfindlichkeit ist bei jedem Menschen unterschiedlich) zu einem Verlust (einer Schädigung) des Hochfrequenzgehörs führen, was bedeutet, dass Lärm pathologische Prozesse wie Verstopfung, Ödeme und Nekrose der Haarzellen verursachen kann, was bedeutet, dass berufsbedingte Hörschäden ein breiteres Spektrum haben. Bei der Diagnose einer berufsbedingten Lärmschwerhörigkeit ist jedoch in der Regel zu beachten, dass es sich um irreversible Hörschäden handelt. Aus diesem Grund hat das Land einige Systeme entwickelt, um regelmäßige Gesundheitschecks bei Arbeitnehmern am Arbeitsplatz durchzuführen. Im Allgemeinen werden Arbeitnehmer mit Hörverlust rechtzeitig identifiziert und rechtzeitig von der Arbeit übertragen, um ihr Gehör zu schützen. |
>>: Lendenwirbelsäule „kleines Problem“
Artikel empfehlen
Pflanzzeit und -methode für Sesam
Sesampflanzzeit Sesam wird hauptsächlich in Somme...
Wie wäre es mit der Abbotsky Construction Company? Abbotsfield Construction Company Bewertungen und Website-Informationen
Was ist die Website der Abbotsky Construction Comp...
Haferbrei mit Yams und Sesam
Ich frage mich, ob Sie schon einmal Yams-Sesam-Br...
Anwendung von 3D-gedruckten Metallprothesen im menschlichen Körper
Autor: Ying Pu, stellvertretender Chefarzt des Ch...
Wie wäre es mit Yahoo Singapur? Yahoo Singapur-Rezensionen und Website-Informationen
Was ist Yahoo Singapur? Yahoo Singapur ist der süd...
Muss die Glanzmispel gründlich gegossen werden? Wie oft sollte gegossen werden?
Ist das Gießen der Photinia ternata gründlich? Di...
Nachteile des Weintrinkens
Wein ist in unserem täglichen Leben weit verbreit...
Wie züchtet man Begonienblüten? Anbaumethoden und Vorsichtsmaßnahmen für Begonienblüten
Begonien sind eine der einzigartigen Blumenarten ...
So isst man grünes Gemüse nährstoffreicher
Die meisten grünen Gemüsesorten enthalten zahlrei...
Nährwert von Pilzen und grünem Gemüse
Es gibt viele Möglichkeiten, Shiitake-Pilze zu es...
Wie ist der McCarran International Airport? McCarran International Airport Bewertungen und Website-Informationen
Was ist die Website des McCarran International Air...
Diäten, die das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren können, planen Sie Ihre Ernährung
In den letzten Jahren haben die Menschen aufgrund...
Schätzen Sie das „Herz des Kindes“ und kümmern Sie sich um das „Herz der Mutter“
Anlässlich des 1. Juni, dem Internationalen Kinde...
Wie weit ist der Mars entfernt? Wie weit ist der Mars entfernt? Bewertungen und Website-Informationen
Wie heißt die Website „How Far is Mars“? Wenn der ...
Pflanzzeit und -methode für Roselle
Roselle Pflanzzeit Roselle eignet sich für die Pf...