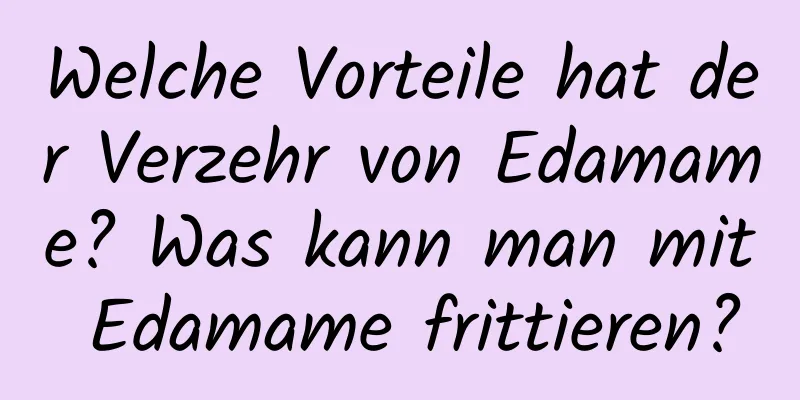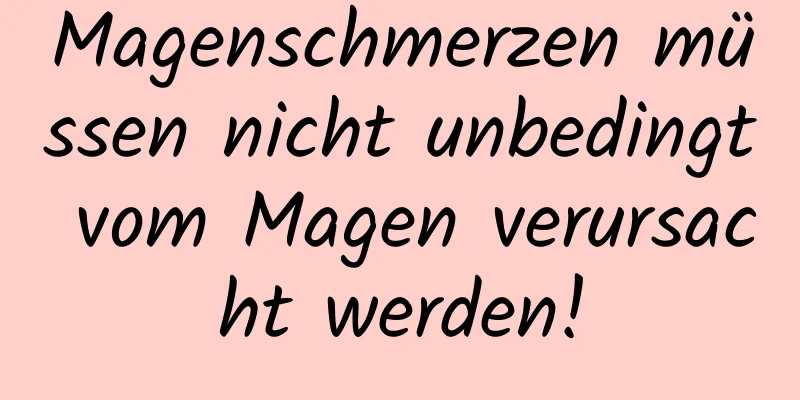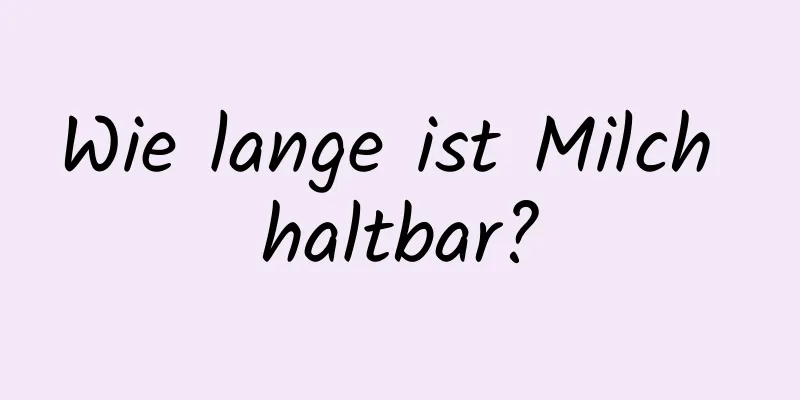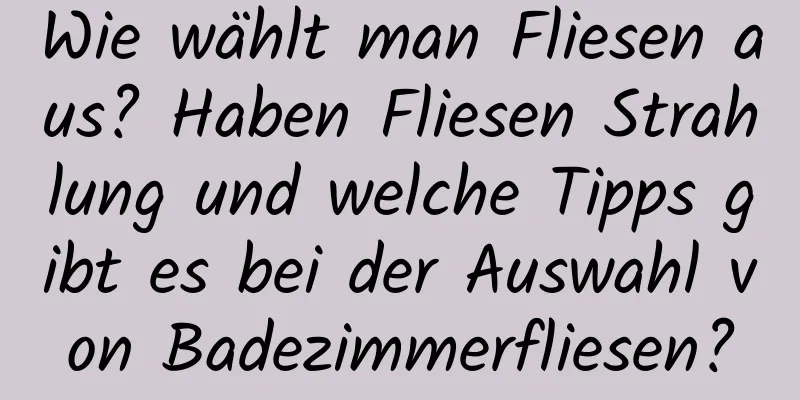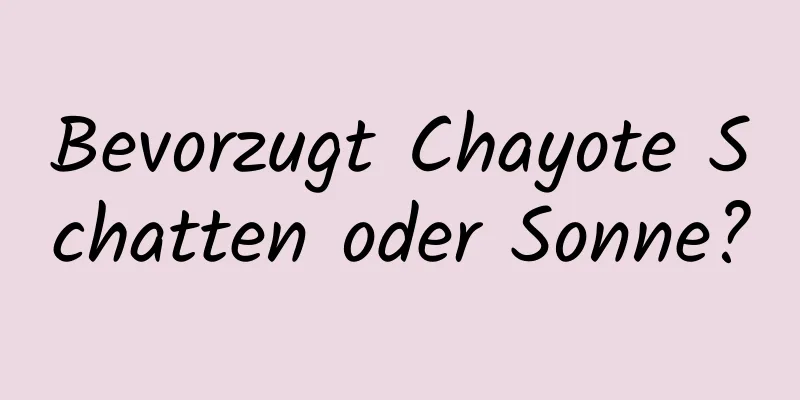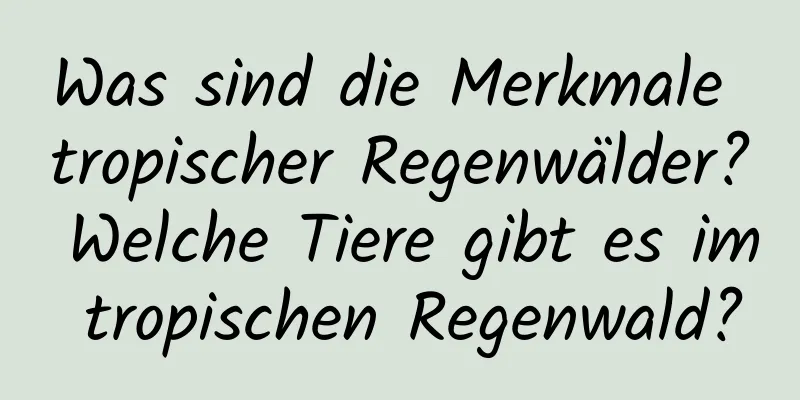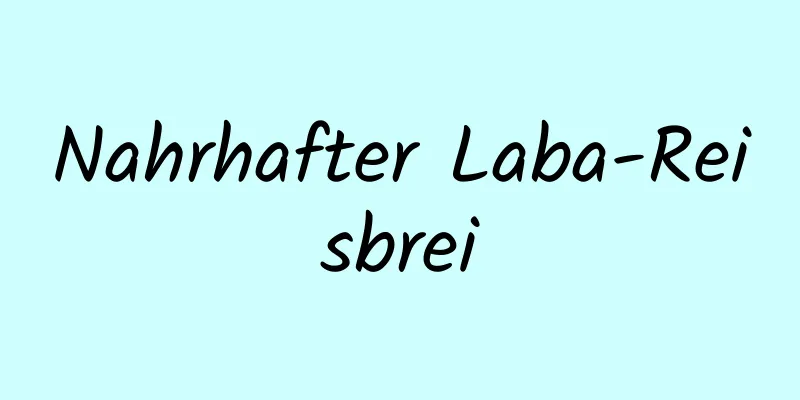Welche Risiken birgt eine Koronarstenose? Wie lässt sich der Grad der Stenose bestimmen?
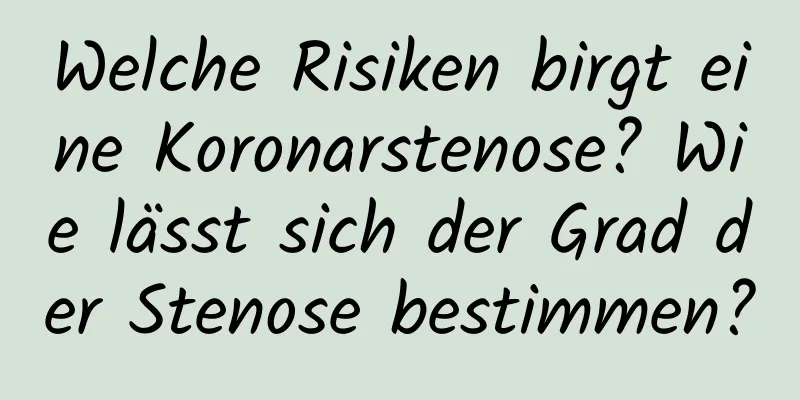
|
Autor: Wang Huaibin, Chefarzt des Pekinger Krankenhauses Gutachter: Zhang Haicheng, Chefarzt, Volkskrankenhaus der Peking-Universität Das Koronararteriensystem besteht hauptsächlich aus der linken und der rechten Koronararterie. Die rechte Koronararterie unterteilt sich in wichtige Äste wie den hinteren absteigenden Ast und den hinteren seitlichen Ast. Die linke Koronararterie teilt sich vom linken Hauptstamm in den linken vorderen absteigenden Ast und den linken Zirkumflexast und ist weiter unterteilt in den intermediären Ast, den diagonalen Ast, den stumpfen Randast usw. Diese Äste können von Arteriosklerose betroffen sein. Abbildung 1 Original-Copyright-Bild, keine Erlaubnis zum Nachdruck Die linke vordere absteigende Arterie ist ein wichtiges Blutgefäß im Koronararteriensystem und der Grad der Stenose ist für die Blutversorgung des Myokards entscheidend. Wenn die Stenose 75 % nicht erreicht, kann die myokardiale Blutversorgung den Bedarf in der Regel decken und der medikamentösen Behandlung kann zu diesem Zeitpunkt Vorrang eingeräumt werden. Sobald die Stenose jedoch 75 % übersteigt, müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden, wie etwa der genaue Ort der Stenose, die Diffusität und der Verkalkungsgrad der Läsion, die Gewundenheit der Blutgefäße, das Vorhandensein von Aneurysmen und die Blutungsgeschichte des Patienten in der jüngeren Vergangenheit (wie etwa Hirnblutungen, positiver Nachweis von okkultem Blut im Stuhl usw.), um zu bestimmen, ob eine Stentimplantation geeignet ist. 1. Wie lässt sich der Grad einer Koronarstenose bestimmen? Mithilfe einer Koronarangiographie lässt sich in der Regel der Grad der Gefäßstenose gut beurteilen und feststellen, ob eine Stentimplantation erforderlich ist. Abbildung 2 Original-Copyright-Bild, keine Erlaubnis zum Nachdruck Wenn der bildgebende Referenzstandard schwer zu bestimmen ist, kann es notwendig sein, sich zusätzlich auf Funktionsindikatoren zu verlassen, von denen der repräsentativste die Blutflussreservefraktion (FFR) der Koronararterien ist. FFR misst das Verhältnis des maximalen Blutflusses, den eine Koronararterie einem bestimmten Myokardbereich bereitstellen kann, wenn in der Koronararterie eine Stenose vorliegt, zum maximalen Blutfluss, den derselbe Myokardbereich erreichen kann, wenn das Blutgefäß nicht stenotisch ist. Kurz gesagt spiegelt es die relative Fähigkeit der verengten Blutgefäße wider, das Myokard mit Blut zu versorgen. Wenn der FFR-Wert über 80 % liegt, kann das Blutgefäß auch bei einer Stenose der Koronararterie immer noch mindestens 80 % des normalen Blutflusses zum Myokard gewährleisten. Zu diesem Zeitpunkt kann eine medikamentöse Therapie das Ungleichgewicht zwischen Blutangebot und -bedarf häufig lindern. Liegt der FFR-Wert hingegen unter 75 %, deutet dies auf eine deutlich unzureichende Blutversorgung hin und es muss möglicherweise eine Revaskularisierung in Betracht gezogen werden, beispielsweise eine Stentimplantation oder eine Koronararterien-Bypass-Operation. Bei FFR-Werten zwischen 75 % und 80 % müssen Kliniker sorgfältige Beurteilungen und Entscheidungen auf der Grundlage einer Vielzahl von Faktoren treffen. 2. Welche Risiken bestehen für Patienten mit koronarer Herzkrankheit, die eine Stentimplantation benötigen, dies aber nicht tun? Wenn der Arzt nach einer Koronarangiographie die Platzierung eines Stents empfiehlt, deutet dies darauf hin, dass der Grad der Koronarstenose schwerwiegender ist. Eine Koronararterienstenose kann die Blutversorgung der Herzmuskelzellen beeinträchtigen und möglicherweise zu einer Myokardischämie führen. Darüber hinaus können Symptome wie Engegefühl in der Brust, Kurzatmigkeit, Engegefühl im Hals und Angina Pectoris auftreten. Wenn eine Myokardischämie über einen längeren Zeitraum anhält, kann sie zu einer Myokardzellnekrose, also einem Myokardinfarkt, führen und mit Komplikationen wie schweren Herzrhythmusstörungen oder einem kardiogenen Schock einhergehen. Diese Komplikationen können aufgrund von Vasospasmen, Plaquerupturen und Thrombosen tödlich sein. Obwohl sich durch eine Anpassung der Lebensgewohnheiten und die Einnahme von Medikamenten das Fortschreiten der koronaren Arteriosklerose wirksam verlangsamen, Lipidplaques stabilisieren und Thrombosen vorbeugen lassen, ist die Möglichkeit, eine bestehende Gefäßstenose allein durch Medikamente und eine Verbesserung des Lebensstils rückgängig zu machen, relativ gering. 3. Ist eine Herzstent-Operation sicher? Nach Jahren der Entwicklung ist die Technologie der Herzstentimplantation mittlerweile ziemlich ausgereift und im Allgemeinen sicher. In der Regel wird dazu die Arteria radialis oder femoralis punktiert und anschließend ein Führungsdraht entlang des Gefäßes bis zur Aortenwurzel und zur Koronararterienläsion geführt. Nach wiederholter Untersuchung mittels rotierendem Schleifgerät oder Führungsdraht wird an der Stenosestelle eine Ballondilatation durchgeführt, um den stenotischen Bereich zu erweitern, und ein Metallstent wird eingesetzt, um die Gefäßdurchgängigkeit aufrechtzuerhalten. Der gesamte Vorgang ist relativ geringfügig. Abbildung 3 Original-Copyright-Bild, nicht autorisierte Reproduktion Da die Stentimplantation jedoch eine Punktion, das Vorschieben des Führungsdrahts und des Katheters in der Koronararterie sowie eine Ballondilatation erfordert, sind diese Schritte dennoch mit gewissen Traumata und Risiken verbunden. In seltenen Fällen können Komplikationen wie Führungsdraht- oder Katheterbruch, Infektionen, Herzrhythmusstörungen oder sogar Gefäßperforationen auftreten. Das Operationsrisiko hängt auch von Faktoren wie dem Grad der Koronararterienverkalkung, dem Grad der Tortuosität und davon ab, ob es sich um eine Notfalloperation handelt. Darüber hinaus beeinflusst auch der individuelle Zustand des Patienten das Operationsrisiko. Je älter der Patient ist, desto geringer ist die Funktionsreserve mehrerer Organe. Patienten mit koronarer Herzkrankheit weisen häufig weitere Komplikationen oder Begleiterkrankungen auf, wie etwa chronische Bronchitis, Emphysem oder Leber- und Nierenfunktionsstörungen, und in der Vorgeschichte gab es sogar schon einmal einen Hirninfarkt, eine Hirnblutung und gleichzeitig Bluthochdruck, Diabetes und andere Erkrankungen. Diese Faktoren erhöhen die Operationsrisiken. Im Allgemeinen ist die Herzstent-Implantation mit einem geringen Risiko und einer hohen Gesamtsicherheit verbunden. |
Artikel empfehlen
Wie wäre es mit dem koreanischen YTN-TV? Testbericht und Website-Informationen zum koreanischen YTN-Fernsehsender
Wie lautet die Website des südkoreanischen Fernseh...
Was tun bei verstopften Blutgefäßen? Keine Angst, neue Technologien zur Gefäßintervention können Ihnen helfen
„Gefäßverschluss“ klingt nach einer harmlosen Erk...
Wie ist das bulgarische Ministerium für Bildung und Wissenschaft? Rezensionen und Website-Informationen des bulgarischen Ministeriums für Bildung und Wissenschaft
Wie lautet die Website des bulgarischen Ministeriu...
Passt auf! Dieser Pilz verbreitet sich in den Vereinigten Staaten mit einer „alarmierenden Geschwindigkeit“ und fast die Hälfte der Infizierten stirbt innerhalb von 90 Tagen!
Bewertungsexperte: Zhang Yuhong Zhengzhou Central...
3 Möglichkeiten, Seitenstechen zu lindern und die Schmerzen beim Atmen einfach loszuwerden
Quelle: Youlai Healthy Life...
So beschneiden Sie fünffarbige Pflaumen
Wann ist der beste Zeitpunkt für den Rückschnitt ...
Brei aus getrocknetem Ingwer
Ich frage mich, wie viel Sie über Brei aus getroc...
Wie man Birnen isst und wann die beste Zeit ist, Birnen zu essen
Die europäische Birne ist eine köstliche Frucht m...
Auf dem Untersuchungsbericht sind so viele Pfeile. Wie kann ich feststellen, ob mit meinem Körper etwas nicht stimmt?
Die Saison der jährlichen körperlichen Untersuchu...
Kann ich zu Hause weiße Pfingstrosen züchten?
Kann ich zu Hause weiße Pfingstrosen züchten? Sie...
Bevorzugt die Kirin-Blume Schatten oder Sonne?
Mag die Blume lieber Schatten oder Sonne? Die Eup...
Ist Meersalat dasselbe wie Seetang? So entfernen Sie den Salzgehalt von Algen
Meersalat ist eine Meeresfrüchteart und hat einen...
Welche Augenkrankheiten treten bei Menschen mittleren und höheren Alters häufig auf?
Katarakt, Glaukom und Augenhintergrunderkrankunge...
Welche Blumen eignen sich zum Pflanzen im Dezember (Welche Topfpflanzen eignen sich zum Pflanzen im Dezember)
Ehe wir uns versehen, rückt das Frühlingsfest imm...