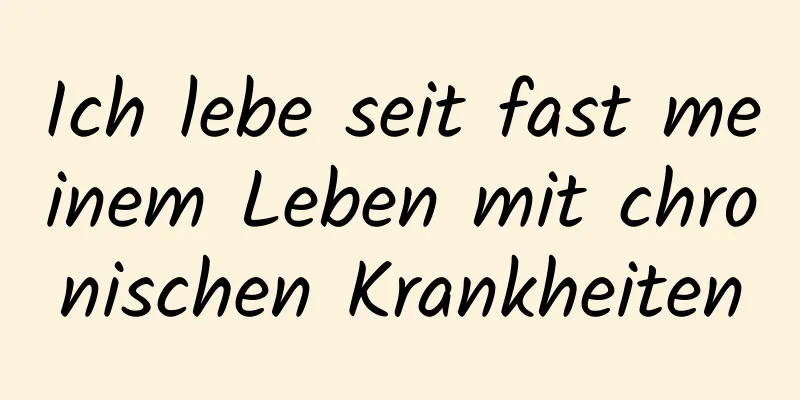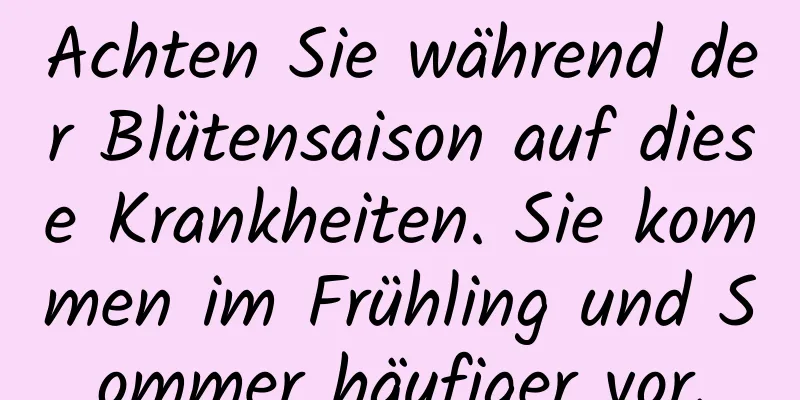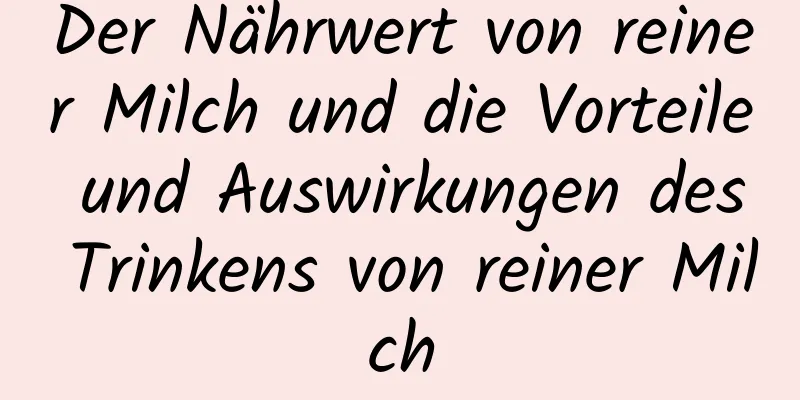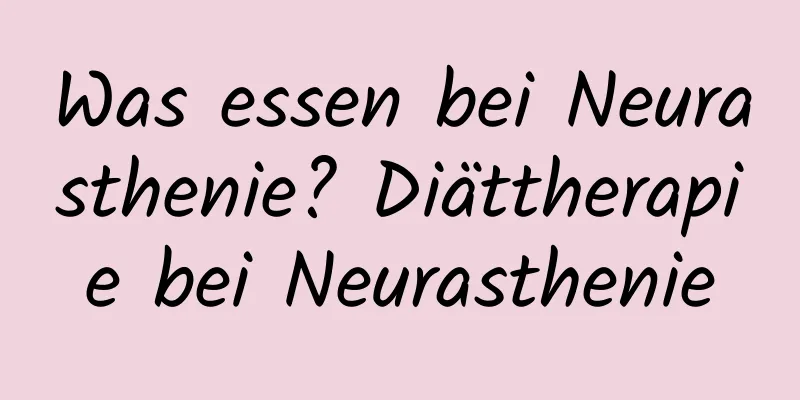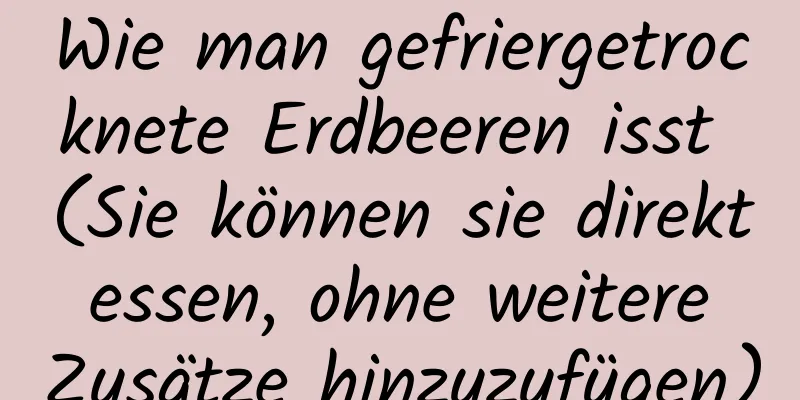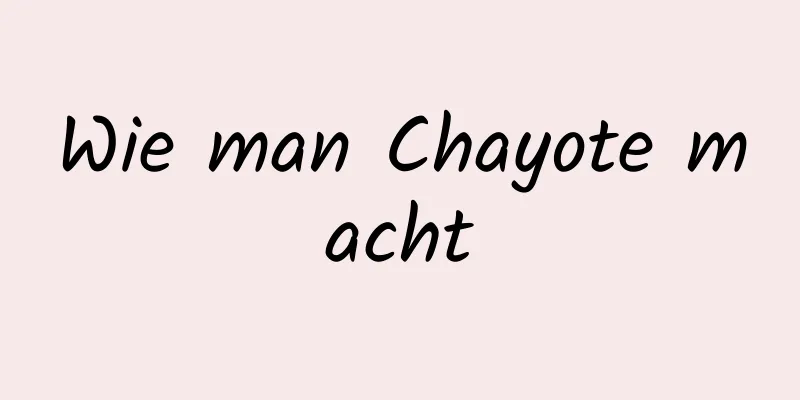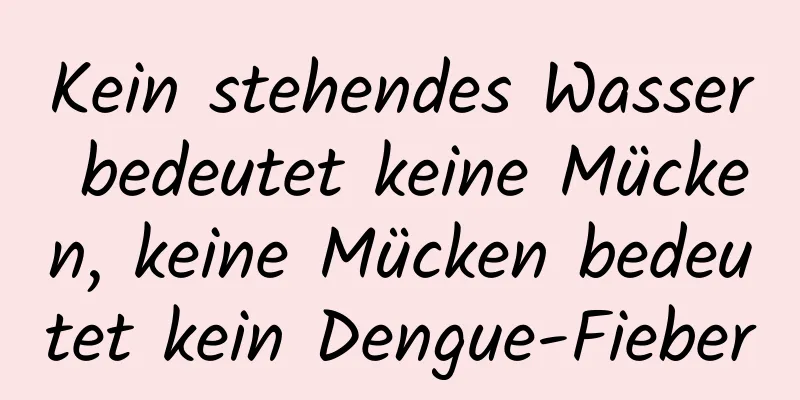Hinweise zur Nierengesundheit (IV) | Wie wird Glomerulonephritis bei Kindern diagnostiziert und behandelt? Schauen Sie sich einfach diese 6 Punkte an!
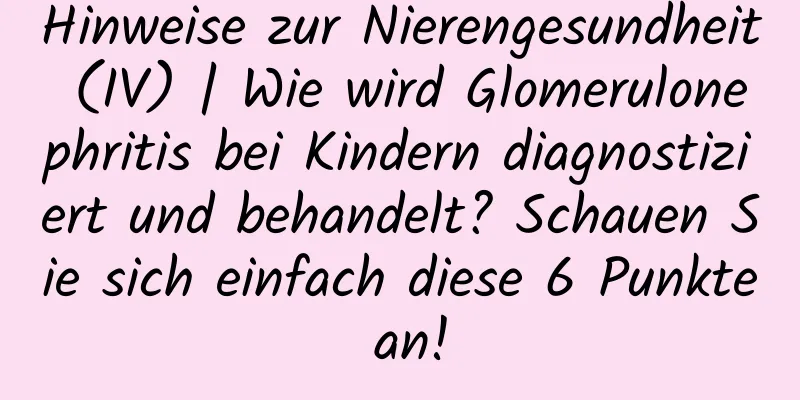
|
Glomerulonephritis (GN) ist eine der häufigsten glomerulären Erkrankungen bei Kindern und beeinträchtigt oft deren Nierengesundheit. Eine fundierte Diagnose und eine klare Behandlung haben einen entscheidenden Einfluss auf die Nierengesundheit von Kindern. Daher fasst dieser Artikel sechs wichtige Punkte zur klinischen Diagnose und Behandlung von GN bei Kindern zusammen, die klinische Ärzte lernen und kommunizieren können. Punkt 1: Klären Sie die vier Merkmale von GN (1) GN bezeichnet ein Spektrum von Erkrankungen, bei denen die Glomeruli geschädigt sind. Die charakteristischen Veränderungen sind in der Regel entzündliche Veränderungen der glomerulären Kapillarschleifen und der glomerulären Basalmembran. (2) Die Verletzung kann den gesamten Glomerulus oder die glomerulären Kapillarschleifen oder Teile davon betreffen. (3) Entzündungen sind meist immunvermittelt. (4) Zu den klinischen Manifestationen zählen Hämaturie (einschließlich mikroskopischer und makroskopischer Hämaturie) und Proteinurie (einschließlich Mikroalbuminurie, Proteinurie auf nicht-nephrotischer Ebene und Proteinurie auf nephrotischer Ebene), mit oder ohne Oligurie/Ödem, Bluthochdruck, abnorme Nierenfunktion und extrarenale Manifestationen. Punkt 2: Klärung der GN-Klassifizierung und -Stufeneinteilung (1) Ätiologieklassifizierung: Je nach Ursache wird GN in primäre GN, sekundäre GN und hereditäre GN unterteilt. Zu den primären GN zählen IgA-Nephropathie, GN nach Streptokokkeninfektion, GN nach Nicht-Streptokokkeninfektion usw.; sekundäre GN umfasst Lupusnephritis, Purpurnephritis, ANCA-assoziierte Vaskulitis, Nierenschäden, hämolytisches urämisches Syndrom und sekundäre glomeruläre Schäden, die durch vererbte Stoffwechselerkrankungen wie Methylmalonazidurie in Kombination mit Hyperhomocysteinämie usw. verursacht werden; Zu den erblichen GN gehört das Alport-Syndrom. (2) Stadien der Krankheit: GN wird basierend auf dem klinischen Verlauf und den Komplikationen in vier Stadien unterteilt: akute, fortschreitende, langwierige und chronische GN. Mit der zunehmenden Verbreitung des Konzepts der chronischen Nierenerkrankung wird die GN klinisch derzeit in zwei Typen unterteilt: akut und chronisch, je nach Krankheitsverlauf. Das heißt, bei Patienten mit einem Krankheitsverlauf von weniger als 3 Monaten handelt es sich um eine akute Erkrankung, bei Patienten mit einem Krankheitsverlauf von ≥ 3 Monaten um eine chronische Erkrankung. Bei der Klassifizierung des Krankheitsverlaufs werden damit verbundene Komplikationen wie Nierenfunktionsstörungen und Bluthochdruck nicht mehr berücksichtigt. (3) Pathologische Klassifikation: GN ist eine Art glomerulärer hyperzellulärer Erkrankung, die durch die Proliferation renaler intrinsischer Zellen und/oder Leukozyteninfiltration gekennzeichnet ist. Basierend auf den unterschiedlichen Ätiologien/Pathogenesen und in Kombination mit Ergebnissen aus Immunfluoreszenz/Histochemie, Lichtmikroskopie und Elektronenmikroskopie wird GN in die folgenden fünf Kategorien unterteilt: Immunkomplex-vermittelte GN, ANCA-assoziierte GN, antiglomeruläre Basalmembran-GN, monoklonale Ig-vermittelte GN und C3-Nephropathie. 1. Immunkomplexvermittelte GN ist die heterogenste Gruppe von Erkrankungen, die durch Immunglobulinablagerungen in der pathologischen Immunfluoreszenz der Nieren gekennzeichnet ist. Art und Ort der Ablagerung hängen von der Ursache ab und gehen häufig mit Komplementablagerungen einher. Die Manifestationen glomerulärer Schäden unter dem Lichtmikroskop variieren. Daher sind zur Bestätigung der Diagnose Immunfluoreszenz und Elektronenmikroskopie erforderlich. 2ANCA-assoziierte GN, Immunfluoreszenz-Immunglobulin oder Komplement sind meist negativ, gelegentlich sind Immunglobulin- und C3-Segmentablagerungen zu sehen und die Lichtmikroskopie zeigt meist nekrotische oder sichelförmige GN mit verschiedenen Volumina und Veränderungsperioden. Daher können zelluläre, zellfaserige und faserige Halbmonde auftreten. 3. Die antiglomeruläre Basalmembran-GN ist durch das Vorhandensein von antiglomerulären Basalmembran-Antikörpern im Serum und lineare Ablagerungen von IgG durch Immunfluoreszenz entlang der glomerulären Basalmembran gekennzeichnet. An der Unterbrechung ist eine Nekrose zu erkennen, die häufig von einer Ablagerung des C3-Segments begleitet wird. In der Lichtmikroskopie sind fortschreitende Halbmonde oder nekrotische GN zu sehen. Im Frühstadium der Erkrankung sind bei einer Nierenpunktion häufig große zelluläre Halbmonde im gleichen Zeitraum zu sehen. Etwa 25 % der Patienten können auch ANCA-positiv sein. Kernpunkt 3: Klärung des Stadiums der Nierenfunktion GN geht häufig mit einer abnormalen Nierenfunktion einher. Derzeit wird in der klinischen Praxis bei Kindern und Erwachsenen eher von akutem Nierenversagen und chronischer Nierenerkrankung gesprochen als von abnormer Nierenfunktion. Die Organisation Kidney Disease Improving Global Outcomes unterteilt akutes Nierenversagen je nach Serumkreatininspiegel in drei Stadien: Stadium 1 ist ein Anstieg des Serumkreatinins um ≥26,5 μmol/l oder ein Anstieg um das 1,5- bis 1,9-Fache; Stadium 2 ist ein Anstieg des Serumkreatinins um das 2,0- bis 2,9-fache; Stadium 3 liegt vor bei einem Anstieg des Serumkreatinins um mehr als das 3,0-Fache oder einem Anstieg des Serumkreatinins um ≥ 353,6 μmol/l oder der Notwendigkeit, eine Nierenersatztherapie einzuleiten, oder der Patient ist < 18 Jahre alt und die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate beträgt < 35 ml/(min·1,73 m²). Chronische Nierenerkrankungen werden entsprechend der glomerulären Filtrationsrate (GFR) in fünf Stadien unterteilt, wie in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1 Schichtungsgrundlage Kernpunkt 4: Typische klinische Manifestationen identifizieren In der akuten Phase treten häufig Symptome wie allgemeines Unwohlsein, Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Fieber, Kopfschmerzen, Schwindel, Husten, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Nasenbluten auf. (1) Ödeme: 70 % der Patienten haben Ödeme, die normalerweise nur die Augenlider und das Gesicht betreffen. In schweren Fällen kann es sich innerhalb von 2 bis 3 Tagen im ganzen Körper ausbreiten und hinterlässt keine Dellen. (2) Hämaturie: In 50 bis 70 % der Fälle liegt eine makroskopische Hämaturie vor, die sich normalerweise nach 1 bis 2 Wochen in eine mikroskopische Hämaturie verwandelt. (3) Proteinurie: unterschiedliches Ausmaß. Bei 20 % kann es zu einer Nierenerkrankung kommen. Bei Patienten mit Proteinurie ist häufig eine ausgeprägte mesangiale Proliferation pathologisch erkennbar. (4) Hypertonie: In 30 bis 80 % der Fälle liegt ein erhöhter Blutdruck vor. (5) Verringertes Urinvolumen: Schwere Fälle von makroskopischer Hämaturie können mit einem verringerten Urinvolumen einhergehen. Darüber hinaus können bei einer kleinen Anzahl von Kindern im Frühstadium der Erkrankung Symptome wie schwere Kreislaufstauung, hypertensive Enzephalopathie und akute Niereninsuffizienz auftreten, was eine klinische Diagnose und eine genaue Beurteilung auf der Grundlage der tatsächlichen Situation der Kinder erfordert. Punkt 5: Komplette Diagnose in 6 Schritten Die Diagnose von GN sollte nach den folgenden Verfahren erfolgen: (1) Symptomdiagnose, ob die klinische Diagnose mit GN übereinstimmt (Hämaturie und Proteinurie sind notwendige Erkrankungen). (2) Verlaufsdiagnostik: Klärung, ob es sich um einen akuten oder chronischen Krankheitsverlauf handelt. Es ist zu beachten, dass, wenn die Ursache als genetische Erkrankung angesehen wird, die Krankheit auch dann als chronisch diagnostiziert werden sollte, wenn die Diagnose weniger als drei Monate zurückliegt. (3) Ätiologische Diagnose: Identifizierung einer primären, sekundären oder hereditären GN. (4) Diagnose der Grunderkrankung. (5) Pathologische Diagnose. (6) Diagnose der Nierenfunktion. Punkt 6: Mehrere Maßnahmen ergreifen und gemeinsam behandeln (1) Achten Sie auf Ruhe: Während der akuten Phase müssen Sie 2 bis 3 Wochen im Bett bleiben, bis die sichtbare Hämaturie verschwindet, das Ödem abklingt und der Blutdruck wieder normalisiert ist. Dann können Sie aus dem Bett aufstehen und ein paar leichte Aktivitäten unternehmen. Menschen mit normaler BSG können zur Schule gehen, sollten jedoch anstrengende körperliche Aktivitäten vermeiden. Erst wenn der Urintest völlig normal ist, können körperliche Aktivitäten wieder aufgenommen werden. (2) Ernährung: Eine natriumarme Ernährung ist wichtig. Patienten mit schweren Ödemen oder Bluthochdruck benötigen eine salzfreie Ernährung. Patienten mit Azotämie sollten die Proteinaufnahme begrenzen. (3) Antiinfektiöse Behandlung: beispielsweise durch den Einsatz von Antibiotika. (4) Symptomatische Behandlung: hauptsächlich Diurese, Senkung des Blutdrucks und Behandlung verwandter Organe. Quellen: [1] Zhang Hongwen. Klassifizierung/Staging und diagnostische Verfahren der Glomerulonephritis bei Kindern[J]. Journal of Clinical Pediatrics, 2023, 41(01): 73-76. |
Artikel empfehlen
Die Wirksamkeit und Funktion von gedämpften getrockneten Litschis
Gedämpfte getrocknete Litschis sind eine Art Troc...
Die Wirksamkeit von Brei aus roten Bohnen und schwarzem Reis
Wie gut kennen Sie die Vorzüge von Brei aus roten ...
Die Wirksamkeit und Funktion von Ma Shuiju
Die Ma Shui-Orange ist eine köstliche Frucht mit ...
Die Wirksamkeit und Funktion von gebratenen Yamswurzeln
Yamswurzeln sind ein weit verbreitetes Nahrungsmi...
Wie wäre es mit dem koreanischen Generalkonsulat in Shenyang? Südkoreanisches Generalkonsulat in Shenyang – Bewertungen und Website-Informationen
Wie lautet die Website des koreanischen Generalkon...
Die Wirksamkeit und Funktion des weißen Granatapfels
Granatäpfel sind in unserem täglichen Leben weit ...
Wie wäre es mit der Barossa Group? Barossa Group-Bewertungen und Website-Informationen
Was ist die Barossa Group? Die Baloise Group ist e...
Wie führt man ein Rehabilitationstraining für Patienten mit Gliedmaßenlähmung, Sinnesbeeinträchtigung und Inkontinenz nach einem Schlaganfall durch?
Autor: Wang Xinglin, Chefarzt des Ersten Medizini...
Kontrapunkt: 59 % der Verbraucher sind bereit, auf die nächste Generation von KI-Smartphones umzusteigen
Eine von Counterpoint in sieben Ländern, darunter...
Wie ist Telecom Paris? Telecom Paris-Rezension und Website-Informationen
Was ist die Website von Telecom Paris? Télécom Par...
Welt-Hepatitis-Tag | Schonen Sie Ihre Leber und reduzieren Sie ihre Belastung
Der 28. Juli ist Welt-Hepatitis-Tag. Dongdong Mia...
Welche Teile vom Rindfleisch sollten zum Grillen von Spießen verwendet werden? Welche Gewürze gibt es für Rinderschmorbraten?
Jeder Teil des Rindfleisches hat einen anderen Ge...
Was soll ich tun, wenn ich während der Epidemie in ein Mädchen verknallt bin? Ist es angebracht, dem Mädchen, das ich mag, nach der Epidemie meine Liebe zu gestehen?
Was sollten Sie während der Epidemie tun, wenn da...
Was ist Honigpulver? Welche Wirkungen und Funktionen hat Honigpulver?
Manche Menschen haben schon einmal von losem Pude...
Wie man eine nahrhafte Schweinerippchensuppe macht
Spareribs sind ein sehr nahrhaftes Stück vom Schw...