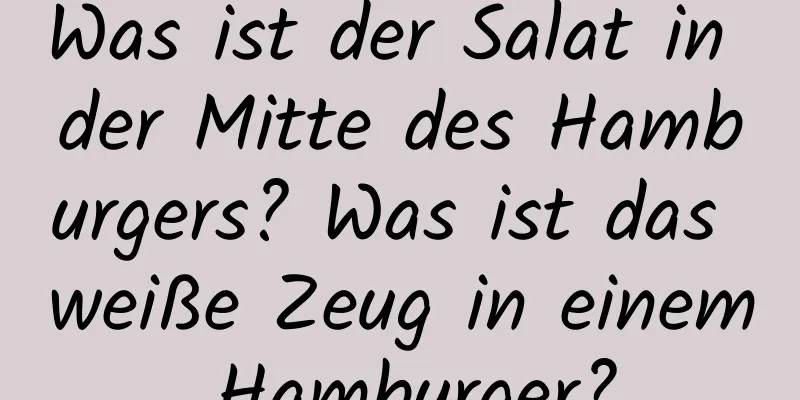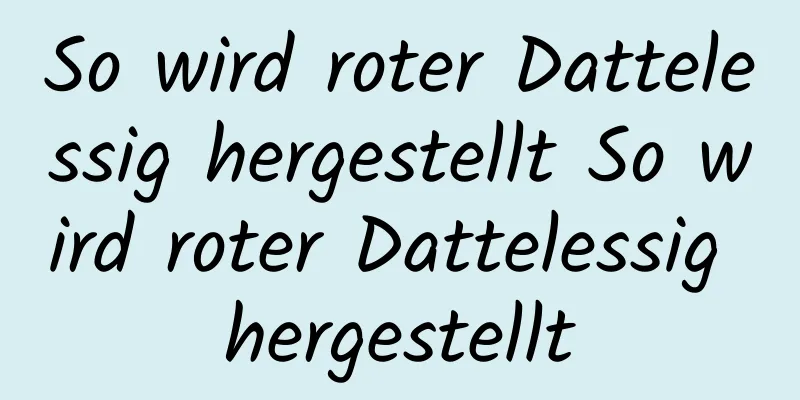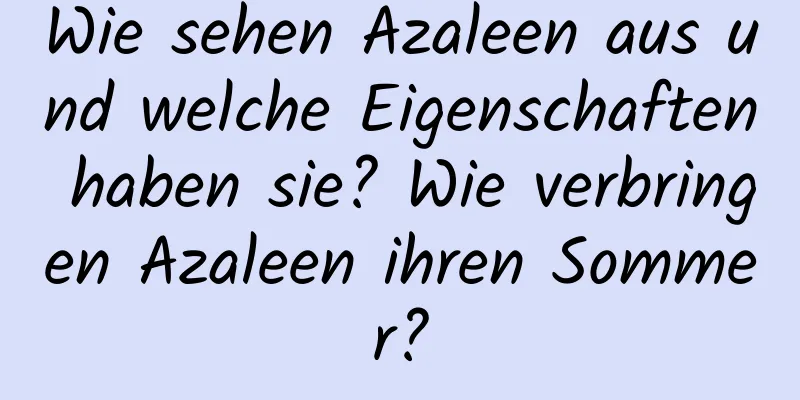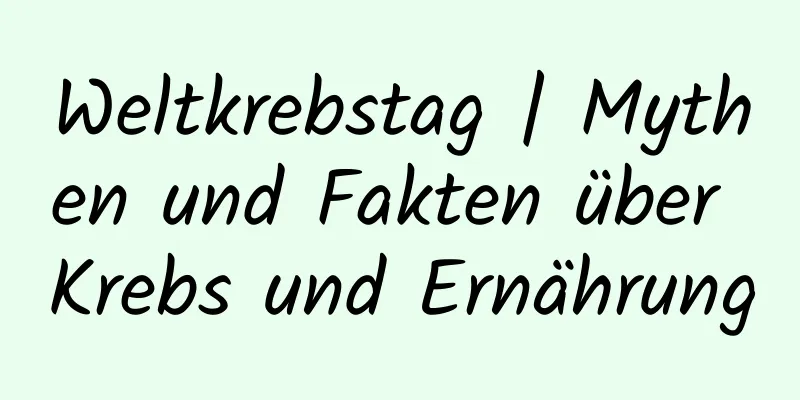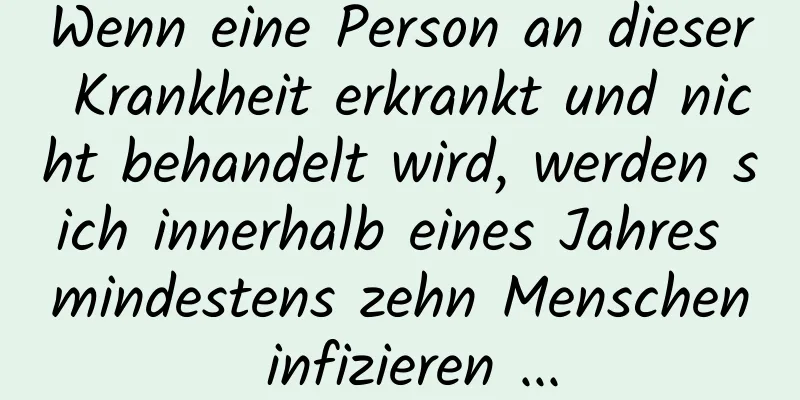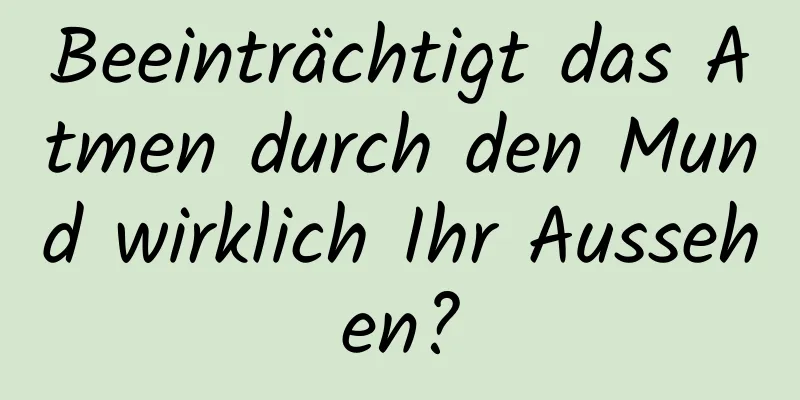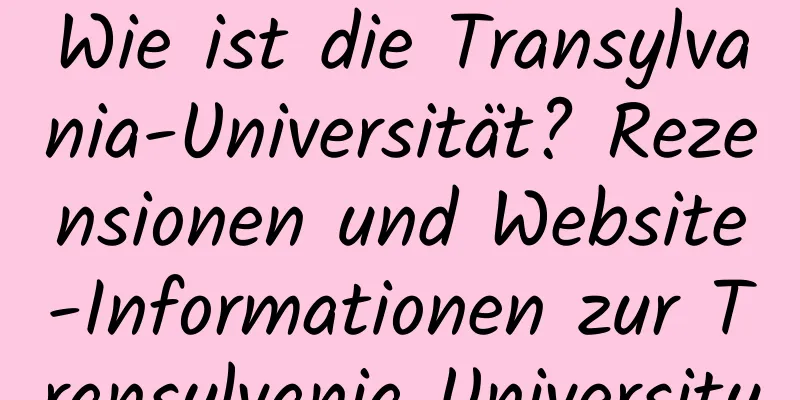Verstehen Sie die drei gängigen Indikatoren zur Beurteilung der Nierenfunktion in einem Artikel
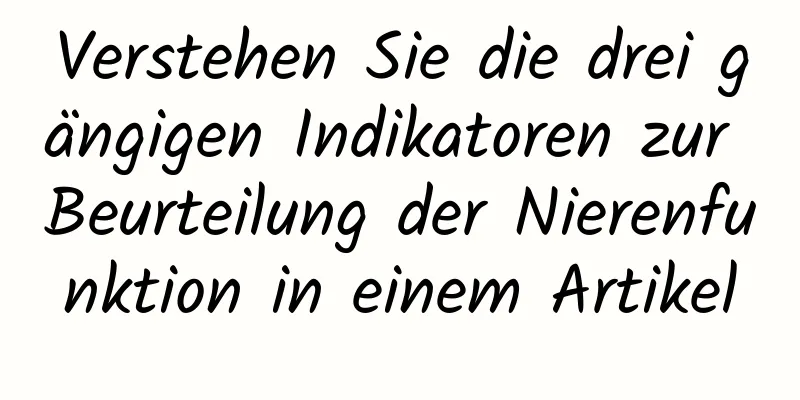
|
Unter Nierenfunktion versteht man die Fähigkeit der Nieren, Stoffwechselendprodukte aus dem Körper auszuscheiden und die Stabilität von Elektrolyten wie Natrium, Kalium und Kalzium sowie das Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper aufrechtzuerhalten. Serumkreatinin, Harnstoffstickstoff und Harnsäure im Blut sind drei häufig verwendete Indikatoren zur Beurteilung der Nierenfunktion in der klinischen Praxis. Heute werde ich die klinische Bedeutung dieser drei Indikatoren im Detail erläutern. Serumkreatinin Serumkreatinin ist ein Produkt des menschlichen Muskelstoffwechsels und muss aus dem Körper ausgeschieden werden. Wenn die glomeruläre Filtrationsfunktion normal ist, wird der größte Teil des Kreatinins gefiltert und ausgeschieden und nur ein kleiner Teil verbleibt im Blut. Daher kann die Kreatininkonzentration im Blut bis zu einem gewissen Grad den Grad der Nierenschädigung widerspiegeln [1]. Der Normalwert für Kreatinin im Blut beträgt bei Männern 54–106 μmol/l und bei Frauen 44–97 μmol/l. Klinische Bedeutung von Serumkreatinin: (1) Erhöhte Serumkreatininwerte können bei akuter und chronischer Glomerulonephritis, akutem und chronischem Nierenversagen, Urämie, Myokarditis und Muskelschäden usw. auftreten. (2) Es ist sinnvoller, Harnstoffstickstoff und Kreatinin gleichzeitig zu messen. Sind beide Werte gleichzeitig erhöht, deutet dies auf eine schwere Nierenschädigung hin. (3) Eine Abnahme kann auf eine fortschreitende Nierenatrophie, Leukämie und Anämie hinweisen. Blutharnstoffstickstoff Unter Harnstoffstickstoff im Blut versteht man eine stickstoffhaltige Verbindung im Plasma, die kein Protein ist und durch glomeruläre Filtration aus dem Körper ausgeschieden wird. Bei Niereninsuffizienz und Dekompensation steigt der Harnstoffstickstoff an und wird daher klinisch als Indikator zur Beurteilung der glomerulären Filtrationsfunktion verwendet. Der Normalwert für Harnstoffstickstoff beträgt bei Erwachsenen 3,2–7,1 mmol/l und bei Säuglingen 1,8–6,5 mmol/l. Klinische Bedeutung des Harnstoffstickstoffs im Blut: (1) Erhöhte Harnstoffstickstoffwerte können bei verschiedenen Nierenparenchymläsionen beobachtet werden, wie z. B. Glomerulonephritis, interstitielle Nephritis, akutem oder chronischem Nierenversagen, polyzystischer Nierenerkrankung usw. Auch raumfordernde und destruktive Nierenläsionen können den Harnstoffstickstoff im Blut erhöhen. Wenn extrarenale Faktoren ausgeschlossen werden können, ist Harnstoffstickstoff auch eines der Kriterien für die Diagnose einer Urämie. (2) Es ist anfälliger für den Einfluss der Ernährung und der Nierendurchblutung. Beispielsweise können Infektionen, Darmblutungen, Hyperthyreose usw. den Harnstoffstickstoffspiegel im Blut erhöhen. Bei schwerer Dehydration und anderen Erkrankungen, bei denen ein unzureichendes Blutvolumen zu einer verringerten Nierendurchblutung führt, steigt der Harnstoffstickstoff deutlich an und kann nach Volumenergänzung von selbst wieder abnehmen. (3) Akute Infektionskrankheiten, hohes Fieber, eine proteinreiche Ernährung usw. erhöhen ebenfalls das Risiko. Unter normalen Umständen beträgt das Verhältnis von Harnstoffstickstoff im Blut zu Kreatinin im Blut etwa 1:10. Eine proteinreiche Ernährung, ein hoher kataboler Zustand, Dehydration, Nierenischämie, unzureichendes Blutvolumen und bestimmte akute Glomerulonephritiden können das Verhältnis erhöhen, während eine proteinarme Ernährung und Lebererkrankungen das Verhältnis verringern können. Harnsäure im Serum Harnsäure ist ein Stoffwechselprodukt des menschlichen Körpers und wird über die Nieren ausgeschieden. Unter normalen Umständen entspricht die Menge an Harnsäure, die der menschliche Körper täglich produziert, der Menge an Harnsäure, die ausgeschieden wird, sodass der Harnsäuregehalt im menschlichen Körper relativ stabil ist. Der Normalwert der Harnsäure beträgt 149–416 μmol/l für Männer und 89–357 μmol/l für Frauen. Erhöhte Harnsäurewerte treten vor allem bei: (1) übermäßiger Harnsäureproduktion auf, die durch bestimmte Enzymdefekte im Purinstoffwechselprozess verursacht werden kann, oder bei übermäßiger Produktion von Harnsäurerohstoffen im Körper, wie z. B. bei myeloproliferativen Erkrankungen, akuter und chronischer Leukämie, hämolytischer Anämie oder Tumorchemotherapie, die eine große Anzahl von Zellproliferationen und -zerstörungen im Körper, einen erhöhten intrazellulären Nukleinsäureabbau usw. verursacht. (2) Beeinträchtigte Harnsäureausscheidung: Eine verringerte Harnsäureausscheidung aufgrund von Niereninsuffizienz und Nierentubuluserkrankungen kann ebenfalls zu Hyperurikämie führen [2]. Quellen: [1] Li Jinlong. Welche klinische Bedeutung hat ein erhöhter Kreatininspiegel? [J]. Gesundes Leben, 2022(07):27. [2] He Yafeng, Li Haibin, Song Bofeng. Analyse der Beziehung zwischen Harnsäure im Serum und Nierenfunktion bei Patienten mit diabetischer Nephropathie und Hyperurikämie[J]. Guizhou Medicine, 2021, 45(12): 1905-1906. |
Artikel empfehlen
Eselshautgelatine und kandierte Datteln
Ich glaube, jeder kennt Eselshautgelatine und kan...
Nebenwirkungen von Lycopin
Mit der kontinuierlichen Verbesserung des Lebenss...
Wie man köstliche gebratene Yamswurzeln zubereitet
Gebratene Yamswurzeln sind das am häufigsten in R...
Welche Wirkung und Funktion haben rote Bohnen?
Rote Bohnen können auf viele Arten verwendet werd...
Wie man Amaryllis züchtet, damit sie blüht
Blütezeit der Amaryllis Bei richtiger Pflege kann...
Wie lang ist der Wachstumszyklus von Huanghuali?
Huanghuali-Wachstumszyklus Der Wachstumszyklus vo...
Kalten Reis in heißem Wasser einweichen. Ich empfehle Ihnen nicht, diese Schüssel mit Essen aus dem Film „Fanhua“ jeden Tag zu essen!
Wurden Sie in letzter Zeit mit der erfolgreichen ...
Wo eignet sich Brunnenkresse zum Anpflanzen?
Brunnenkresse-Anbaugebiet Brunnenkresse wächst im...
Wie wäre es mit der Yamaki Company? Yamaji-Unternehmensbewertungen und Website-Informationen
Was ist die Website der Yamaki Company? Yamaki Co....
Wird die Leber nicht geschädigt, wenn man nicht betrunken wird? Ist es gut, Fleisch zu essen und Tee zu trinken, während man Alkohol trinkt? Die Wahrheit ist...!
Autor: Fan Jiangao, Chefarzt des Xinhua-Krankenha...
Atembeschwerden sind mehr als nur eine Erkältung – erkennen Sie die Symptome und suchen Sie sofort einen Arzt auf
Autor: Mi Yuhong, Chefarzt, Beijing Anzhen Hospit...
Welche Haaranforderungen gelten für die Beantragung eines Personalausweises? Ist der Ausweis wasserdicht?
Ein Personalausweis ist ein juristisches Dokument...
Wie wäre es mit der Banco Sabadell? Banco Sabadell Bewertungen und Website-Informationen
Was ist Banco Sabadell? Banco de Sabadell ist die ...
Welchen Einfluss haben Mikroorganismen – Freund und Feind zugleich – auf die menschliche Gesundheit?
Mikroben sind die Könige der Erde Lebensraum für ...