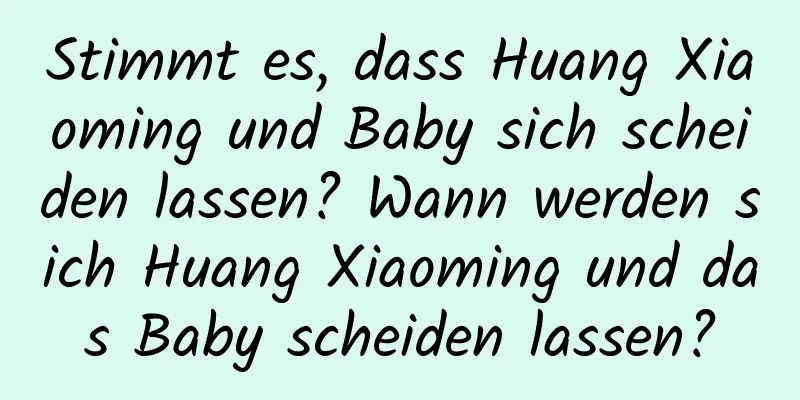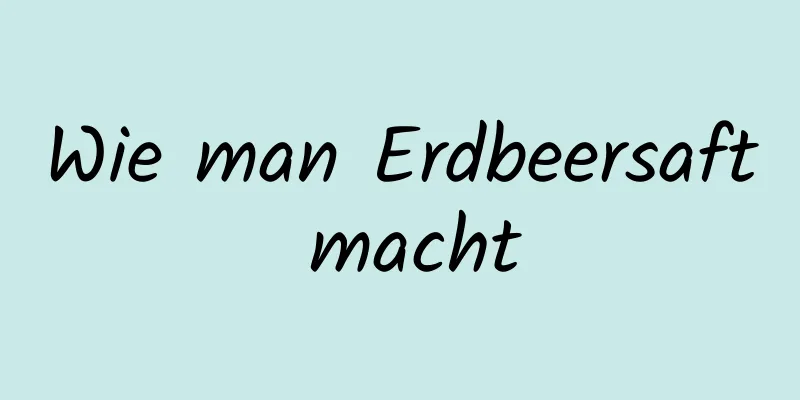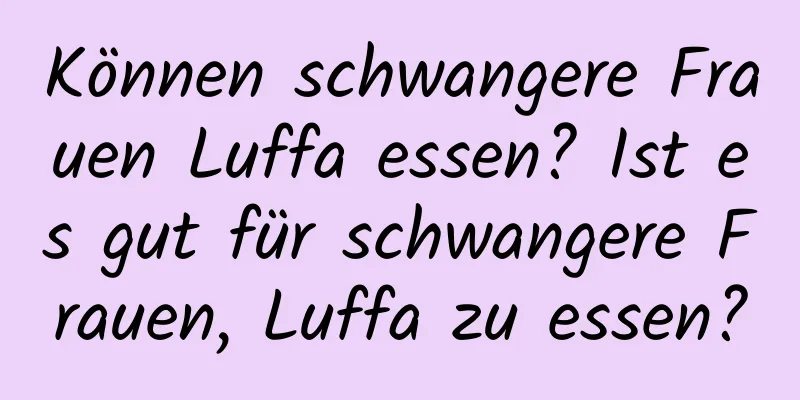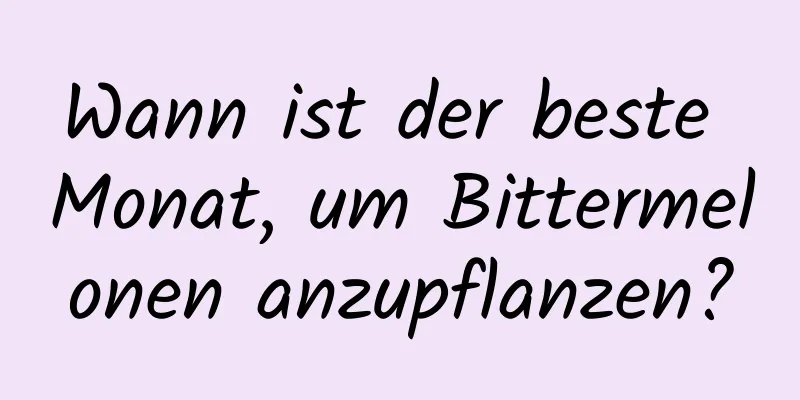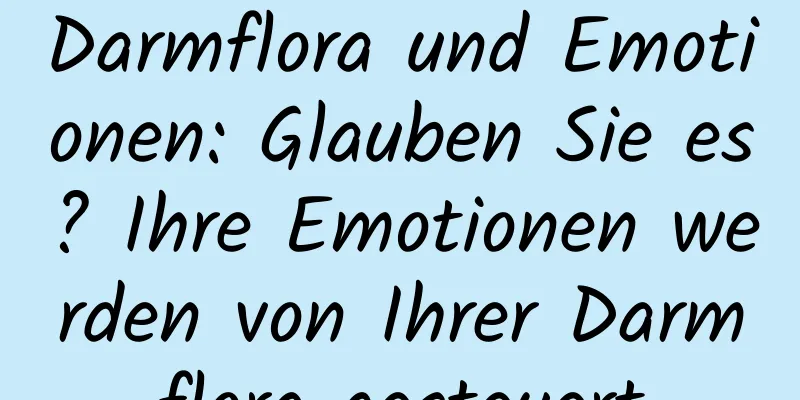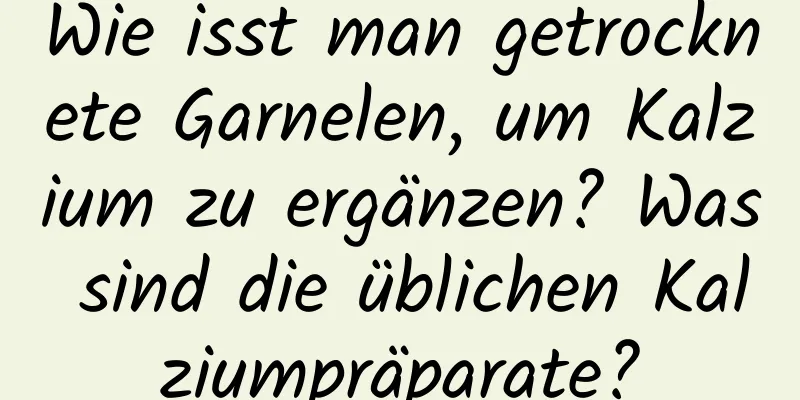Wie kann man die „medizinische Sucht“ überwinden? Den seltsamen Baron hinter dem Münchhausen-Syndrom entlarven

|
Leviathan Press: Beim Münchhausen-Syndrom denkt man leicht an Hypochondrie, einen psychischen pathologischen Zustand, bei dem eine Person glaubt, an einer bestimmten Krankheit zu leiden, ohne dass hierfür eine klare medizinische Grundlage besteht. In der Ausgabe 2013 des DSM-5 wurde die Diagnose Hypochondrie jedoch gestrichen und durch Krankheitsangststörung und Somatisierungsstörung ersetzt. Die Bemühungen, das Spektrum der Krankheitsangst zu beschreiben, reichten jedoch nicht aus, um die Mehrdeutigkeit der Hypochondrie zu klären. Diese scheinbar hilfreichen Begriffe bewirken in Wirklichkeit wenig. Obwohl wir heute mehr über die Krankheiten und psychischen Störungen wissen, die uns plagen, bleiben die hartnäckigsten Rätsel unseres Körpers weiterhin ungeklärt. Ärzte und Patienten müssen gemeinsam zurechtkommen. Der einzige Weg, dies zu erreichen, besteht darin, jeden Impuls zur Moralisierung beiseite zu lassen und die Unsicherheit zu akzeptieren – und genau dazu ist die moderne Medizin am wenigsten in der Lage. Im Jahr 1951 schrieb der Londoner Arzt Richard Asher einen Zeitschriftenartikel über „ein häufiges Syndrom, das die meisten Ärzte beobachten, über das aber selten berichtet wird“[1]. Er beschreibt eine Gruppe scheinbar kranker Menschen mit dramatischer, aber plausibler Krankengeschichte, zahlreichen Krankenhausbesuchen, Auseinandersetzungen mit medizinischem Personal und Selbstentlassungen gegen ärztlichen Rat. Kurz gesagt litten diese Menschen unter dem, was heute als Münchhausen-Syndrom bekannt ist, einer psychischen Störung, bei der der Betroffene vorgibt, er selbst oder jemand anderes (meist ein Kind) sei schwer krank. Wenn für die Krankheit medizinische Namenskonventionen wie Alois Alzheimer (deutscher Psychiater, der als Erster Fälle von Alzheimer veröffentlichte) oder Burrill Bernard Crohn (amerikanischer Gastroenterologe, nach dem „Morbus Crohn“ benannt ist) übernommen worden wären, hätte man sie vielleicht „Morbus Asher“ genannt. Doch das war nicht der Fall, denn Ashe war nicht scharf darauf, seinen guten Namen mit einer Pseudokrankheit in Verbindung zu bringen, die seiner Meinung nach von „einem Hysteriker, einem Schizophrenen, einem Masochisten oder irgendeiner Art von Psychopathen“ erfunden worden war. Stattdessen begann Dr. Ash, in der Literatur nach Inspiration zu suchen. Er fand Inspiration in einem heute vergessenen Roman des deutschen Autors Rudolf Erich Raspe aus dem Jahr 1785: Baron Münchhausens Erzählungen seiner wunderbaren Reisen und Feldzüge in Russland. Illustration der Abenteuer des Baron Münchhausen, 1890. © Wikimedia Commons Der Roman wurde ursprünglich als anonymer Artikel veröffentlicht und erfuhr, genau wie Gullivers Reisen, unzählige Neuadaptionen. In dem Roman ist Münchhausen ein edler Soldat im Ruhestand, der seine eigenen bizarren Abenteuer in der ersten Person erzählt, und seine Geschichten sind so offensichtlich absurd, dass sie die Gäste beim Bankett aufregen. Zu Münchhausens vielen Abenteuern gehörten sein Flug über die Themse auf einer Kanonenkugel, sein Kampf mit einem zwölf Meter langen Krokodil und sogar seine Reise zum Mond. Begleitet wird die Geschichte natürlich von originellen Illustrationen. Eine Illustration aus der Romanausgabe von 1786 zeigt Baron Münchhausen, wie er an einem Seil an einer Mondsichel hängt. Es ist ein Lieblingswort der Literaturwissenschaftlerin Sarah Tindal Kareem von der UCLA, die es für das Cover ihres 2014 erschienenen Buches „Eighteenth-Century Fiction and the Reinvention of Wonder“ auswählte. „Das 18. Jahrhundert war eine einzigartige Epoche, in der es weder klare Urheberrechts- noch Verleumdungsgesetze gab und auch keine strikte Unterscheidung zwischen faktischen und fiktionalen Werken vorgenommen wurde“, sagte Karim. Genau dies trifft auf Raspes Roman zu, da sein Münchhausen-Roman auf einem Mann basiert, der damals noch lebte und fast denselben Namen trug. Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen war ein deutscher Offizier im Ruhestand, der mit der Russischen Legion in zwei Feldzügen gegen das Osmanische Reich gekämpft hatte. Ab 1760 führte er ein müßiges Leben auf dem deutschen Land und bewirtete regelmäßig Adlige in seinem Haus in Hannover. Münchhausen war freundlich, großzügig und lebhaft und für seine Fähigkeit bekannt, dramatische Geschichten zu erzählen. er war kein Lügner. Sowohl die echten als auch die fiktiven Barone waren anfangs hoch angesehene Persönlichkeiten. „In Raspes Buch dachte Münchhausen, dass seine Gäste Unsinn redeten, und erzählte immer absurdere und bizarrere Geschichten, um sich über ihre Leichtgläubigkeit lustig zu machen“, sagte Karim. Sie schätzt, dass Raspes Roman in den folgenden zwei Jahrhunderten 100 Mal nachgedruckt wurde. Bei jeder Bearbeitung und Übersetzung ändert sich der Text geringfügig. „In späteren Versionen ändert sich dies jedoch und er ist nicht mehr derjenige, der den Witz erzählt, sondern der Witz selbst“, erklärt Karim. „Er wird zum Clown, zum Lügner und zur komischen Figur.“ Ein Porträt aus den 1740er Jahren, das vermutlich Baron Münchhausen zeigt. © Wikimedia Commons Zweifellos wurde die Neufassung der fiktiven Figur zumindest teilweise durch Reaktionen auf das reale Münchhausen-Syndrom vorangetrieben. „Es wäre schön gewesen, wenn er einfach mit dem Strom geschwommen wäre“, sagte Karim, „aber seine Überreaktion hat die Situation verschlimmert.“ Münchhausen konnte die Situation nicht mit Humor nehmen. Ihm gefiel die Darstellung seiner Person nicht und er drohte mehrmals mit einer Klage. Neben der Unklarheit des Verleumdungsgesetzes zu dieser Zeit wurde die Klage des Barons durch ein unüberwindbares Problem behindert: Der Autor des immer beliebter werdenden Buches blieb damals anonym. Münchhausen versuchte, Gottfried August Bürger, der den Roman ins Englische übersetzt hatte, zu verklagen, war jedoch erfolglos. Der wütende Münchhausen wusste, dass jemand (vielleicht jemand, den er zu sich nach Hause eingeladen hatte) durch das Verspotten von ihm reich geworden war oder geworden war. Als wolle er sich vor einer Verleumdungsklage schützen, hat der Autor die Schreibweise des Namens des Protagonisten absichtlich verändert. „Raspe hat in diese grandiose Fiktion eine reale, identifizierbare historische Figur eingefügt“, sagte Karim. Seit Jahrhunderten können Historiker nicht verstehen, warum Raspe seinen Protagonisten auf Münchhausen basierte. Eine Illustration aus dem Jahr 1872 zeigt Münchhausen, wie er auf einer Kanonenkugel fliegt. © Wikimedia Commons Baron Münchhausen kämpft gegen ein Krokodil. © Wikimedia Commons „Wir wissen nicht einmal, ob sie sich getroffen haben“, sagt Régis Olry, Anatom an der Universität von Quebec und Autor eines Artikels aus dem Jahr 2002 über die Geschichte des Münchhausen-Syndroms.[2] Die Wege der beiden Männer könnten sich an der Universität Göttingen in Deutschland gekreuzt haben, wo Raspe Anfang der 1760er Jahre als Bibliothekar arbeitete, um seine wachsenden Schulden abzubezahlen. Etwa zur selben Zeit gab Münchhausen (dessen Onkel maßgeblich an der Gründung der Universität beteiligt war) auf seinem Anwesen in der Nähe seines Wohnhauses ein üppiges Abendessen. Wie Karim glaubt auch Orrie nicht, dass der sogenannte „Baron der Lügen“ ein Lügner ist. „Münchhausen war ein Geschichtenerzähler“, sagte er, und wenn die Geschichten nicht ganz der Wahrheit entsprachen, dann gab es dafür zwei Gründe: „Entweder erfand sie absichtlich, um sein Publikum zu unterhalten (und es funktionierte), oder es handelte sich um Unsinn, von dem er nichts wusste.“ Münchhausen ging 1760 (im Alter von 39 oder 40 Jahren) in den Ruhestand, daher ist es unwahrscheinlich, dass er neben Größenwahn auch an anderen Wahnvorstellungen litt. Für Münchhausen war Raspe ein anonymer Folterer, aber was war Münchhausen für Raspe? Im Jahr 1785 waren mehr als 20 Jahre vergangen, seit der (wahrscheinlich) viel jüngere Rasp den Baron kennengelernt hatte, und er muss einen großen Eindruck auf ihn gemacht haben. Doch Raspes Meinung zum Münchhausen-Syndrom bleibt ein Rätsel. War er aufgrund seiner eigenen bescheidenen Stellung eifersüchtig auf den Reichtum und Status des Barons? Bewunderte er Münchhausens erzählerische Fähigkeiten und betrachtete den Roman als Kompliment? Hinweise auf die Faszination Münchhausens finden sich in Raspes Biografie. Raspe wurde 1737 in Hannover geboren und studierte Rechtswissenschaften an der Universität Göttingen, wurde jedoch nie Anwalt. Raspe verfügt über einen umfangreichen Lebenslauf als Autor, Forscher, Übersetzer, Journalist, Bibliothekar, Geologe und Münzwart – Positionen, die ihn in Kontakt mit verlockendem Reichtum brachten. Raspe wurde später des Diebstahls der Münz- und Edelsteinsammlung des Museums beschuldigt und floh 1775 nach England. Raspe wurde zunehmend unzuverlässig und begann, sich mit Geldbetrug und Kleinkriminalität zu beschäftigen. Einer der Betrügereien bestand beispielsweise darin, vorzutäuschen, auf dem Anwesen eines schottischen Adligen eine Goldmine entdeckt zu haben, ihn zu überreden, in den Bergbau zu investieren, und dann mit dem Geld zu verschwinden. Das Betrügen der nicht ganz so hellen Oberschicht schien Raspes Spezialität zu sein. In der Zwischenzeit „erinnerte er sich in seiner Verzweiflung und Demütigung an Geschichten, die er bei Baron Münchhausens Festen gehört hatte, und da er dachte, er könne sie für sich nutzen, veröffentlichte er … seine Erinnerungen daran“, notierte der Schriftsteller Samuel Austin Allibone im Jahr 1908. Diese waren „zweifellos grandios, aber im Großen und Ganzen den Geschichten so ähnlich, die Baron Münchhausen zur Belustigung seiner Saufkumpanen erfunden hatte, dass ihr Ursprung erkennbar ist.“ Raspey sprach fließend Deutsch, Englisch, Französisch und Latein und verfasste neben Gedichten und Forschungsarbeiten auch verschiedene andere schriftstellerische Arbeiten. Wenn er jedoch durch das Schreiben Ruhm und Reichtum gesucht hätte, wäre die Geschichte des Baron Münchhausen für ihn ein Verlust gewesen. Die große Ironie besteht darin, dass zu Raspes Lebzeiten seine erfolgreichsten Werke nicht seine Handschrift trugen. Schließlich würde die Geltendmachung des Eigentums an dem Werk bedeuten, den echten Münchhausen vor Gericht zu bringen. Am Ende überlebte Baron Münchhausen Raspe um drei Jahre. Ersterer starb 1797 und wusste nichts von der Identität seines Gegners, während letzterer 1794 starb. Erst 1824 wurde durch die Veröffentlichung einer Biographie des angeklagten Übersetzers Burge der wahre Autor des Romans enthüllt. Im Laufe der nächsten 200 Jahre wurde das Wort „Münchhausen“ allmählich populär. Laut dem Oxford English Dictionary[3] wurde es in den 1850er Jahren am häufigsten als Verb, im Slang, verwendet, um „eine höchst unwahre pseudo-autobiografische Geschichte“ zu beschreiben. In den 1950er Jahren war das Wort so allgegenwärtig, dass Ashe dachte, es sei der perfekte Spitzname für sein neues Syndrom. Der Arzt schrieb: „Wie beim berühmten Baron Münchhausen werden Menschen mit diesem Syndrom oft in Umlauf gebracht, und ihre Geschichten sind, wie seine, sowohl dramatisch als auch unwahr.“ Bisher wurde die Erkrankung als Krankenhaussuchtsyndrom , Thick-Chart-Syndrom und Hospital- Hopper-Syndrom bezeichnet .[4] Die offizielle Bezeichnung im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) lautet „auf sich selbst bezogene artifizielle Störung“ oder „auf einen anderen bezogene artifizielle Störung“[5]. Umgangssprachlich bezeichnet man den Zustand jedoch lieber mit dem ehemals guten Ruf des Barons. Außerhalb sehr spezifischer literarischer Kreise ist Raspes Name praktisch unbekannt, während Münchhausens Name ein allgemein bekannter Name ist. Wenn die Geschichte einen anderen Verlauf genommen hätte, wären die Positionen dieser beiden Männer möglicherweise völlig vertauscht gewesen. „Raspe war ein schillernder, extravaganter Charakter, aber er war auch in betrügerische Aktivitäten verwickelt“, sagte Karim. Manche Lügen sind beliebt, andere sind illegal, doch die Entwicklung dieser Unterscheidung und ihre nachfolgenden Auswirkungen sind nahezu zufällig. Wenn Sie also das nächste Mal bei einer Dinnerparty eine Geschichte überdramatisieren, bedenken Sie Folgendes: In dreihundert Jahren wird man vielleicht immer noch über Sie reden, im Guten wie im Schlechten. Von Rosemary Counter Übersetzt von Tim Korrekturlesen/tamiya2 Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von Tim auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
>>: Gängige Antipyretika für Kinder, unterschiedliche Anwendungsgebiete sollten beachtet werden
Artikel empfehlen
Wie man Feigen vermehrt und worauf man achten muss
Feigenvermehrungsmethode Zu den üblichen Methoden...
[Fat Bear Science] Manche Narben im Gesicht sind in Ordnung, aber manche können sich zu Krebs entwickeln. Auf diese Narbenarten sollten Sie achten
Heutzutage lassen sich immer mehr Menschen Ohrlöc...
Wie lässt sich rotes Sandelholz besser anbauen? Wo eignet sich der Anbau von rotem Sandelholz?
Obwohl das kleinblättrige rote Sandelholz nicht s...
Welche Arten von Malariaparasiten gibt es? Verstehst du das alles?
Malaria ist eine schwere und manchmal lebensbedro...
So machen Sie Ihren eigenen Orangensaft So machen Sie Orangensaft zu Hause
Frischer Orangensaft enthält viel Vitamin C und F...
Die Wirkung und Funktion der Bergamotte und wie man Bergamotte anbaut
Bergamotte ist eine Frucht mit einem besonders ei...
Die Wirksamkeit und Funktion des weißen Granatapfels Der medizinische Wert des weißen Granatapfels
Der weiße Granatapfel ist eine Granatapfelart, di...
Die Wirksamkeit und Funktion von drei frischen Pilzen. Die Zubereitungsschritte von drei frischen Pilzen
Drei frische Pilze ist ein Gericht aus Pilzen und...
Wie wäre es mit Austrian Airlines? Austrian Airlines Bewertungen und Website-Informationen
Was ist die Website von Austrian Airlines? Austria...
Weltherztag – Schützen Sie Ihre Herzgesundheit. Wissen Sie, dass diese „Herzangelegenheiten“ wichtig sind?
Der Weltherztag wurde 1999 von der World Heart Fe...
Anbaumethoden und Vorsichtsmaßnahmen für Jasmin
Stiftspitze-Jasmin ist eine wunderschöne Zierpfla...
Kann Bewurzelungspulver zum direkten Gießen von Blumen verwendet werden? So verwenden Sie es richtig
Kann Bewurzelungspulver zum direkten Gießen von B...
Falscher Gebrauch von Medikamenten kann Ihr Leben ruinieren! Wie viele Kinder nehmen immer noch die falschen Medikamente? Diese Punkte müssen Eltern beachten
Experte dieses Artikels: Dr. Qin Wei, Chefapothek...
Welche Vorteile und Verwendungsmöglichkeiten haben Litschikerne?
Litschikerne sind ein wertvolles medizinisches Ma...
Welche Vorteile bietet der Verzehr von Wassermelonen? Welche Vorteile bietet der Verzehr von Wassermelonen?
Der Sommer steht wieder vor der Tür und Wassermel...