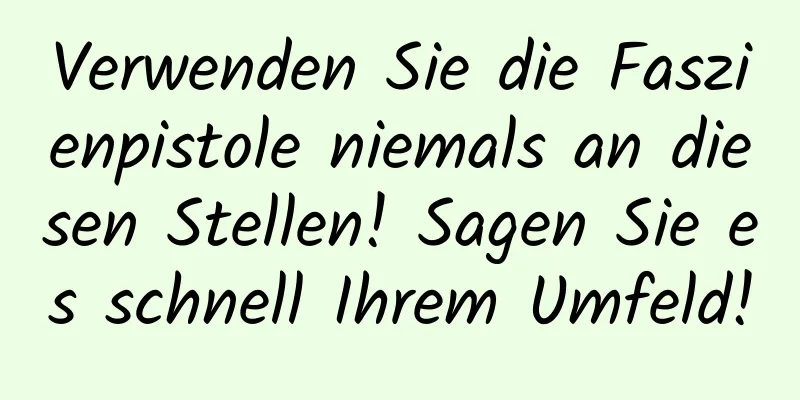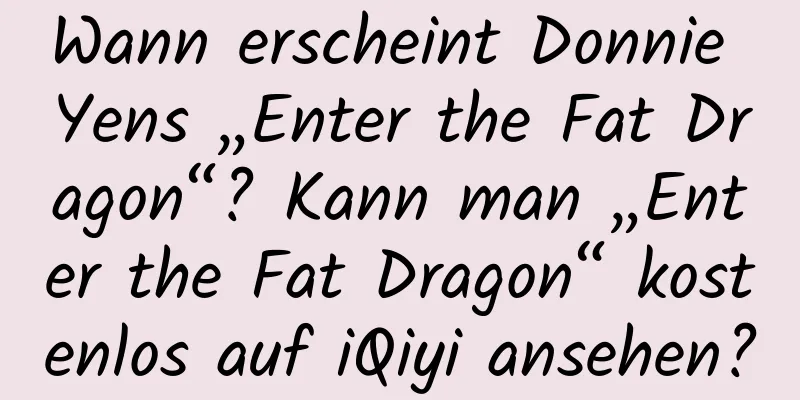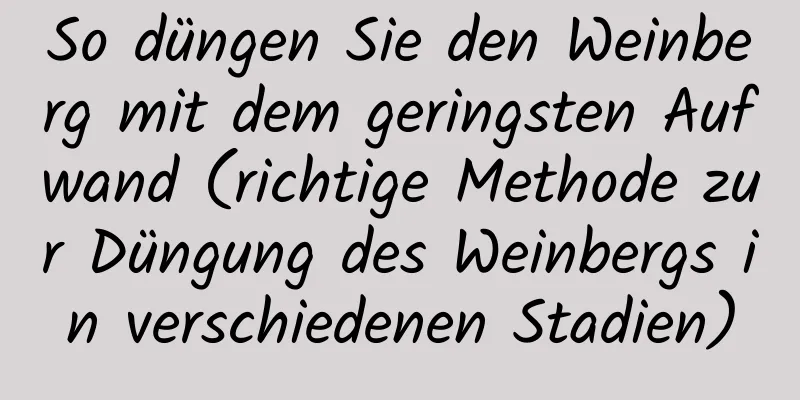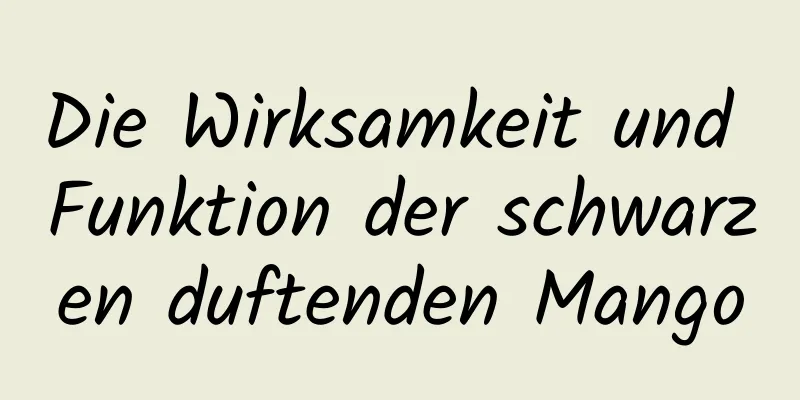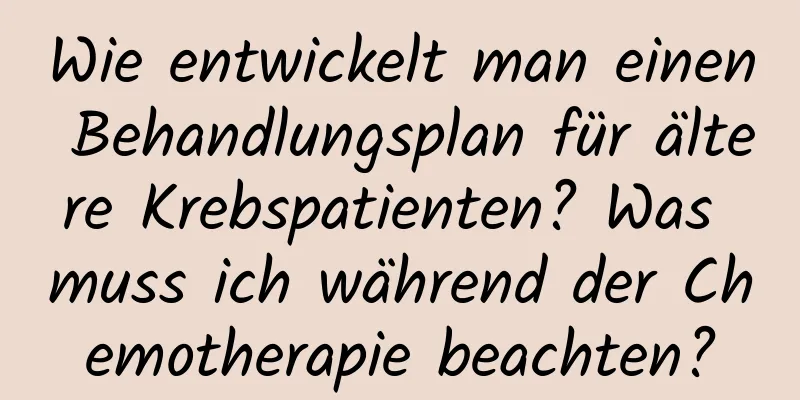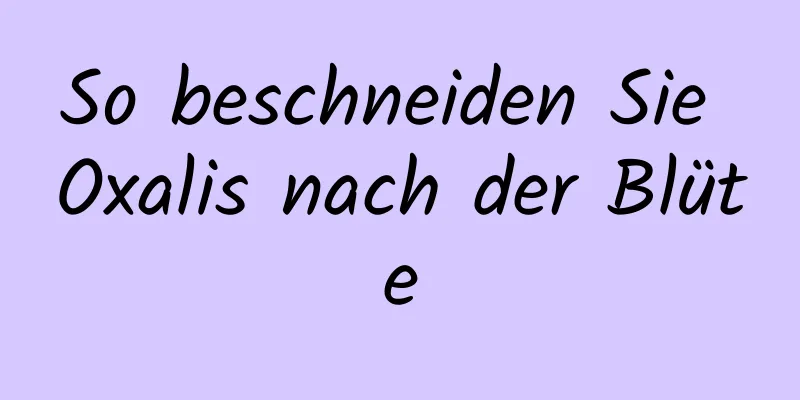Kannst du noch gut pinkeln? So viele Menschen haben eine überaktive Blase ...

|
Leviathan Press: Schätzungsweise haben viele Menschen ähnliche Erfahrungen gemacht: Wenn Sie es eilig haben zu pinkeln und plötzlich etwas Dringenderes als das bloße Bedürfnis zu pinkeln auftritt, widmet sich Ihr Gehirn sofort der Bewältigung dieses Notfalls – zu diesem Zeitpunkt verspüren Sie keinen Drang zu pinkeln, als ob der Urin in Ihrer Blase, der kurz vor dem Explodieren steht, nicht vorhanden wäre. Die Menschen sind schon lange neugierig auf den Signalkontroll- und Rückkopplungsmechanismus zwischen Gehirn und Blase: Warum möchte Ihr Gehirn, dass Sie auf die Toilette gehen, obwohl Sie keinen Urin haben? Was genau ist Nykturie? Was verursacht Harninkontinenz? Sie fahren, den Blick auf die Straße gerichtet, als Sie plötzlich einen stechenden Schmerz im Unterleib spüren. Das große Glas Cola, das ich vor einer Stunde getrunken habe, ist bereits durch meine Nieren in meine Blase gelangt. Sie denken sich: „Zeit, einen Parkplatz zu finden“, und beginnen, nach der Ausfahrtrampe zu suchen. Für die meisten Menschen ist es eine alltägliche Erfahrung, zum Pinkeln auf eine Autobahnraststätte zu fahren. Aber für die Neurowissenschaftlerin Rita Valentino ist das nicht so alltäglich. Sie untersucht, wie das Gehirn Signale aus der Blase wahrnimmt, interpretiert und verarbeitet. Valentino war fasziniert von der Fähigkeit des Gehirns, die Sinnessignale der Blase aufzunehmen, sie mit Signalen aus der Umgebung (wie den Bildern und Geräuschen der Straße) zu kombinieren und diese Informationen dann zu nutzen, um Maßnahmen zu ergreifen (einen sicheren, geeigneten Ort zum Urinieren zu finden). „Für mich ist das ein Beispiel für die wunderbaren Dinge, die das Gehirn tut“, sagte sie. Früher glaubten Wissenschaftler, dass unsere Blase durch einen relativ einfachen Reflex gesteuert wird – einen „Schalter“ zwischen der Speicherung und Abgabe von Urin. „Jetzt ist uns klar, dass es viel komplizierter ist“, sagte Valentino, heute Direktor der Abteilung für Neurowissenschaften und Verhalten am National Institute on Drug Abuse. An diesem Prozess ist auch ein komplexes Netzwerk von Gehirnregionen beteiligt, die an Funktionen wie Entscheidungsfindung, sozialer Interaktion und der Wahrnehmung innerer Körperzustände (auch Interozeption genannt) beteiligt sind. Das System ist nicht nur äußerst komplex, sondern auch äußerst fragil. Wissenschaftler schätzen, dass mehr als einer von zehn Erwachsenen an einer überaktiven Blase (OAB) leidet – einer häufigen Gruppe von Symptomen, zu denen Harndrang (das Gefühl, urinieren zu müssen, auch wenn die Blase nicht voll ist), Nykturie (häufige nächtliche Toilettengänge) und Harninkontinenz gehören. © Getty Images Obwohl bestehende Behandlungen bei manchen Menschen die Symptome lindern können, wirken sie bei vielen nicht, sagt Martin Michel, ein Pharmakologe an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, der sich mit der Behandlung von Blasenerkrankungen beschäftigt. Die Entwicklung wirksamer Medikamente ist eine so große Herausforderung, dass alle großen Pharmaunternehmen diese Bemühungen aufgegeben haben. Allerdings eröffnen neue Forschungsergebnisse in jüngster Zeit neue Bereiche für neuartige Hypothesen und Therapien. Während sich die Behandlung von Blasenerkrankungen in der Vergangenheit auf die Blase selbst konzentrierte, wies Valentino darauf hin, dass neue Forschungsergebnisse nahelegen, dass auch das Gehirn ein potenzielles therapeutisches Ziel sei. Indira Mysorekar, Mikrobiologin am Baylor College of Medicine in Houston, sagt, diese Studien sollen erklären, warum bestimmte Gruppen, wie etwa Frauen nach der Menopause, häufiger an Blasenproblemen leiden, und dass wir nicht einfach davon ausgehen sollten, dass Symptome wie Inkontinenz unvermeidlich sind. „Besonders Frauen wird oft gesagt, dass diese Probleme einfach zum Altern dazugehören, und obwohl das bis zu einem gewissen Grad stimmt“, sagte sie, seien viele häufige Probleme vermeidbar und könnten erfolgreich behandelt werden. „Wir müssen nicht mit Schmerzen oder Beschwerden leben“, sagte sie. Ein empfindliches Gleichgewicht Im Grunde genommen ist die menschliche Blase ein dehnbarer Beutel. Um das Urinvolumen zu füllen (die meisten gesunden Erwachsenen halten 400 bis 500 Milliliter oder etwa 2 Tassen) muss es die extremste Ausdehnung aller Organe im menschlichen Körper erfahren und sich aus seinem leeren Zustand etwa sechsmal ausdehnen. © Wikipedia Um diese Dehnung zu erreichen, muss sich die glatte Muskelwand, die die Blase umgibt, der sogenannte Detrusormuskel, entspannen. Gleichzeitig muss sich der Schließmuskel, der die untere Öffnung der Blase (die Harnröhre) umgibt, zusammenziehen. Dieser Vorgang wird von Wissenschaftlern als „Wachreflex“ bezeichnet. Ob gefüllt oder leer, die Blase verbringt mehr als 95 % der Zeit im Speichermodus und ermöglicht uns, unseren täglichen Aktivitäten nachzugehen, ohne dass es zu Auslaufen kommt. Irgendwann – idealerweise wenn wir entscheiden, dass es Zeit ist, auf die Toilette zu gehen – schaltet die Blase vom Speichermodus in den Entleerungsmodus um. Dazu muss sich der Detrusormuskel kräftig zusammenziehen, um den Urin auszustoßen, während sich gleichzeitig der Schließmuskel, der die Harnröhre umgibt, entspannt, um den Urinabfluss zu ermöglichen [1]. Es sind nicht nur die sensorischen Neuronen (lila), die Empfindungen wie Dehnung, Druck, Schmerz usw. in der Blase erkennen. Andere Zelltypen, wie etwa die Schirmzellen, die die Urothelbarriere für den Urin bilden, können ebenfalls mechanische Kräfte wahrnehmen und darauf reagieren – beispielsweise durch die Freisetzung chemischer Signalmoleküle wie Adenosintriphosphat (ATP), wenn sich das Organ mit Urin füllt. © E. Underwood/Knowable Seit einem Jahrhundert untersuchen Physiologen, wie der Körper den Wechsel zwischen Speicherung und Freisetzung koordiniert. In den 1920er Jahren suchte ein Chirurg namens Frederick Barrington am University College London nach der Stelle, die für diesen Schalter im Hirnstamm verantwortlich ist, dem untersten Teil des Gehirns, der mit dem Rückenmark verbunden ist. Barrington führte Experimente an sedierten Katzen durch, bei denen er mit elektrischen Nadeln die Brücke, einen Teil des Hirnstamms, der für wichtige Funktionen wie Schlaf und Atmung zuständig ist, leicht schädigte. Als die Katzen wieder zu Bewusstsein kamen, bemerkte Barrington, dass einige von ihnen einen Harndrang zeigten (Kratzen, Kreisen oder Hocken), aber nicht in der Lage waren, selbstständig zu urinieren. Katzen mit Schäden an verschiedenen Teilen der Brücke verloren offenbar das Bewusstsein für das Urinieren, urinierten zu zufälligen Zeiten und wirkten überrascht, wenn es passierte. Offenbar ist die Brücke eine wichtige Kommandozentrale für das Wasserlassen, die der Blase mitteilt, wann sie Urin abgeben soll. Jenseits des Barrington-Kerns Barringtons Arbeit legte den Grundstein für unser heutiges Verständnis der neuronalen Schaltkreise zur Blasenkontrolle. Doch heute wissen wir, dass nicht nur die Brücke betroffen ist. Wenn sich die Blase mit Urin füllt, senden der Detrusormuskel und die Dehnungssensorzellen in der Auskleidung der Blasenwand ein Füllsignal entlang des Rückenmarks an einen Teil des Hirnstamms, der als periaquäduktale Grauzone (PAG) bezeichnet wird. Das Signal wird dann an einen Bereich namens Inselrinde weitergeleitet, der als eine Art Sensor fungiert: Je voller die Blase ist, desto mehr Neuronen in der Inselrinde senden winzige elektrische Impulse aus, die als Aktionspotentiale bezeichnet werden. Als nächstes berechnet der für Planung und Entscheidungsfindung zuständige Bereich des Gehirns – der präfrontale Kortex –, ob dies ein sozial akzeptabler Zeitpunkt zum Urinieren ist. Wenn die Antwort „Ja“ lautet, sendet es ein Signal zurück an die graue Substanz im Periaquädukt, die wiederum ein Entwarnungssignal an den Teil der Brücke sendet, den Barrington bei seinen Katzenexperimenten entdeckt hat und der heute Barrington-Kern heißt. Dieses Signal wird an die Blase zurückgesendet und voilà, es kommt zum Urinieren. © Metro Im letzten Jahrzehnt ist es dank hochpräziser Werkzeuge wesentlich komplexer geworden, die Verbindungen und Interaktionen zwischen verschiedenen Gehirnregionen abzubilden. Valentino und ihr Team verwendeten eine Technik, mit der die elektrische Aktivität von Neuronen in mehreren Teilen des Gehirns gleichzeitig überwacht und analysiert werden kann. Wenn die Blase einen bestimmten Füllstand erreicht, beginnt der Locus coeruleus im Hirnstamm, sich in einem gleichmäßigen Rhythmus zu entleeren. Diese Aktivitätswelle wandert zur äußeren Hirnrinde und versetzt das Gehirn für etwa 30 Sekunden vor dem Wasserlassen in einen wacheren und aufmerksameren Zustand. Valentino hofft, dass Beobachtungen wie diese als Grundlage für die Behandlung häufiger Probleme wie Nykturie und Enuresis dienen können. Außerdem könnten sie möglicherweise auch zur Erklärung einiger grundlegender Phänomene beitragen, die bei den meisten Menschen auftreten. „Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum man zum Pinkeln aufstehen muss“, sagt Valentino. „Es ist, als ob der Locus coeruleus sagen würde: ‚Hör auf mit dem, was du gerade tust, und konzentriere dich aufs Pinkeln.‘“ Lerne es zu kontrollieren Es braucht Zeit, bis wir die Kontrolle darüber entwickeln, wann und wo wir pinkeln. Das kann jeder bestätigen, der schon einmal einem Kleinkind beigebracht hat, aufs Töpfchen zu gehen. Bei der Geburt wird das Wasserlassen des Menschen nicht vom Gehirn gesteuert, sondern durch einen Rückenmarksreflex, der einsetzt, wenn die Blase eine bestimmte Kapazität erreicht. Erst im Alter von etwa drei oder vier Jahren gehen die Gehirnbereiche, die für Funktionen wie soziales Bewusstsein und Entscheidungsfindung verantwortlich sind, über die Reflexe hinaus, sagt Hanneke Verstegen, Neurowissenschaftlerin am Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston und an der Harvard Medical School. Es ist uns unmöglich zu beobachten, wie dieser Prozess im Hirnstamm eines menschlichen Säuglings abläuft. Doch Westergen und ihre Kollegen untersuchen einen ähnlichen Prozess an Labormäusen, die innerhalb von etwa drei bis fünf Wochen eine willkürliche Kontrolle über das Wasserlassen entwickeln. Dann hätten die Mäuse angefangen, in dafür vorgesehene Ecken zu pinkeln, ein Verhalten, das dem von Kleinkindern, die schon auf die Toilette gehen, nicht unähnlich sei, sagte sie. Interessanterweise verschwinden die primitiveren automatischen Rückenmarksreflexe, die wir als Kleinkinder haben, nicht vollständig: Wenn eine Rückenmarksverletzung die Nerven beeinträchtigt, die Signale zwischen der Blase und dem Gehirn übertragen, können die Reflexe wieder auftreten, was oft zu Inkontinenz oder anderen Zuständen führt, die den Einsatz eines Katheters erforderlich machen. Dies ist eine vereinfachte Darstellung einiger Nervenbahnen und Gehirnregionen, die es den meisten gesunden Menschen ermöglichen, zu spüren, wann ihre Blase voll ist oder sich füllt, vorherzusagen, wie lange sie mit dem Urinieren warten können, und erfolgreich einen Plan zum „Anhalten“ oder „Ausschütten“ auszuführen. Störungen auf jeder Ebene dieses komplexen Zweiwege-Neuralkommunikationssystems können zu Blasenproblemen führen, wie sie Millionen von Menschen auf der ganzen Welt erleben. © knowablemagazine Eine Rückenmarksverletzung ist nur einer von vielen Gründen, warum es zu Problemen bei der Kommunikation zwischen Gehirn und Blase kommen kann. Mit zunehmendem Alter des Gehirns können auch die Synapsen, die Informationen an die Bereiche übertragen, die das Wasserlassen steuern, ihre Integrität verlieren, was zu Störungen der normalen Blasenfunktion führen kann – ein Prozess, der bei Parkinson und Alzheimer oft beschleunigt wird. Becky Clarkson, Medizinphysikerin an der Universität Pittsburgh, und ihre Kollegen nutzen bildgebende Verfahren wie die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRI), um zu verstehen, wie die Gehirnmechanismen, die das Wasserlassen kontrollieren, versagen. Dazu beobachten sie, welche Teile des Gehirns aufgrund von Schwankungen des Sauerstoffgehalts im Blut aktiv sind.[2] „Wir versuchen herauszufinden, welche Bahnen beeinträchtigt sein könnten“, sagte sie. „Wie steuert das Gehirn normalerweise die Blase? Und warum gelingt ihm das nicht?“ Wenn die Blase leer oder teilweise gefüllt ist, ist sie mit Falten bedeckt (hier in einem künstlich gefärbten Querschnitt der Blasenwand einer Maus dargestellt). Beim Menschen kann dieses zusätzliche Gewebe die Größe eines Organs um das Fünf- oder Sechsfache vergrößern. © MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG VON PATAPOUTIAN LAB / SCRIPPS RESEARCHER INSTITUTE, LA JOLLA, CA Die meisten Teilnehmerinnen an Clarksons Studie waren Frauen über 60, also die Bevölkerungsgruppe mit der höchsten Rate an überaktiver Blase. Etwa 11 % der Gesamtbevölkerung leiden unter einer überaktiven Blase, aber mehr als 45 % der Frauen nach der Menopause berichten, dass sie dieses Symptom haben. Die Wissenschaftler sind sich nicht sicher, was die Ursache für eine überaktive Blase ist und warum sie bei Frauen mittleren und höheren Alters so häufig auftritt. Einige weisen auf Veränderungen in der Blase selbst hin. Eine von ihnen ist Mysoreka, die herausfand, dass während der Menopause eine Vermehrung von Immunzellen winzige Knoten auf der Blasenschleimhaut von Frauen bildet, die Lymphknoten ähneln. Diese Läsionen können die Empfindlichkeit der Blase gegenüber selbst kleinsten Mengen von E. coli (dem Bakterium, das die meisten Harnwegsinfektionen verursacht) erhöhen, was zu chronischen Blasenschmerzen oder einer überaktiven Blase führen kann. Eine weitere Hauptursache für eine überaktive Blase bei Männern und Frauen ist eine Detrusorüberaktivität, d. h. unregelmäßige Kontraktionen des Blasenmuskels, die falsche Signale der Fülle an das Gehirn senden [3]. Alle bestehenden Behandlungen zielen darauf ab, diese Kontraktionen zu lindern: Die am häufigsten verwendete Medikamentenklasse sind Antimuskarinika, die die Aktivität von Acetylcholin blockieren – einem Nervensignalstoff, der Detrusorkontraktionen auslöst. Wenn Medikamente nicht wirken, empfehlen Ärzte häufig, dem Detrusormuskel Botulinumtoxin zu injizieren, damit er sich nicht übermäßig zusammenzieht. Manchmal versuchen sie auch, die normale Aktivität der Spinalnerven, die die Blasenmuskulatur steuern, wiederherzustellen, indem sie über ein chirurgisches Implantat oder auf der Haut angebrachte Elektroden einen elektrischen Strom an die Spinalnerven senden. Das Problem bei all diesen Behandlungen zur Detrusorkontrolle bestehe darin, dass sie nachteilige Nebenwirkungen haben könnten, darunter in einigen Fällen eine Beeinträchtigung der Harnfähigkeit, sagte Michel. „Es ist ein schmaler Grat: Wenn Sie zu viel tun, können Sie nicht urinieren; wenn Sie nicht genug tun, bekommen Sie Speicherprobleme“, sagte er. Antimuskarinika werden mit Symptomen eines kognitiven Abbaus in Verbindung gebracht, insbesondere bei älteren Erwachsenen, was Sicherheitsbedenken aufwirft. Darüber hinaus haben nicht alle Menschen mit einer überaktiven Blase einen überaktiven Detrusormuskel. Dies veranlasst einige Wissenschaftler zu der Frage, ob das Problem bei manchen Patienten woanders im Körper liegt, beispielsweise im Gehirn. Komm gut nach Hause Wenn Sie schon einmal nach einem langen Arbeitstag nach Hause gekommen sind und in dem Moment, als Sie die Tür aufgeschlossen haben, einen plötzlichen, überwältigenden Drang verspürt haben, auf die Toilette zu müssen, dann haben Sie das erlebt, was Wissenschaftler als eine enge Verbindung zwischen Gehirn und Blase bezeichnen. © ESTHER AARTS Diese Art von Harndrang, die sogenannte Schlüsselinkontinenz, hat nichts damit zu tun, wie voll Ihre Blase ist. (Dies unterscheidet sich auch von der Unfähigkeit, den Harndrang beim Niesen, Husten oder Springen zu kontrollieren: Dieses häufige Problem wird als Belastungsinkontinenz bezeichnet und wird normalerweise durch eine schwache Beckenbodenmuskulatur verursacht.) Einige Wissenschaftler glauben, dass der Harndrang bei einer überaktiven Blase bedingt sein könnte, so wie der russische Physiologe Iwan Pawlow in den 1890er Jahren Hunden beibrachte, Futter mit dem Klang eines Metronoms zu assoziieren. Clarkson und sein Team gehen von der Hypothese aus, dass sich diese Konditionierung bei manchen Menschen über Jahre hinweg entwickelt, in denen sie darauf warten, nach Hause zu gehen und ihre eigene Toilette zu benutzen. Bei anderen können verschiedene Situationen Auslöser sein, beispielsweise das Geräusch von fließendem Wasser. Es ist normal, wenn diese intensiven Gefühle gelegentlich auftreten. Wenn sie jedoch zu häufig auftreten, könnten sie nach Ansicht der Forscher Anlass zur Sorge geben. Clarkson und andere Forschungsteams haben herausgefunden, dass Frauen mit überaktiver Blase tendenziell abnormale Muster der Gehirnaktivität aufweisen. Bei einem Experiment in Clarksons Labor lagen die Teilnehmer flach in einem fMRI, während über einen Katheter Flüssigkeit in ihre Blase infundiert wurde, bis sie sagten, sie hätten genug. Anschließend entnimmt der Techniker etwas Flüssigkeit und führt sie erneut ein. Der Vorgang wird mehrere Male wiederholt. Mithilfe dieses Ansatzes erstellten Clarkson und sein Team ein Modell zur Steuerung der Blase durch das Gehirn. Dabei wurden Bereiche wie die Inselrinde, die die Füllsignale der Blase verarbeitet, und der präfrontale Kortex einbezogen, der dabei hilft, den richtigen Zeitpunkt und Ort zum Urinieren zu bestimmen. Zwei weitere Bereiche, der supplementär-motorische Bereich (SMA) und der anteriore cinguläre Cortex (ACC), scheinen zusammenzuarbeiten, um den Harndrang zu erkennen und die Kontraktionen der Beckenbodenmuskulatur auszuführen, die uns helfen, unseren Urin zurückzuhalten, bis wir eine Toilette finden. Bei manchen Menschen mit einer überaktiven Blase neigen diese Bereiche zu einer erhöhten Aktivität, was zu einem überwältigenden Harndranggefühl führen kann, selbst wenn die Blase nur teilweise gefüllt ist. „Wir betrachten das fast als eine Notstation“, sagte Clarkson. „Wenn Sie den geringsten Drang verspüren, zu pinkeln, gehen Sie dorthin.“ Vor einigen Jahren bemerkte einer von Clarksons Kollegen, dass der intensive Harndrang, der bei einer überaktiven Blase auftritt, dem Drang ähnelt, den ehemalige Raucher in bestimmten Situationen verspüren, beispielsweise in einer Bar, in der sie früher geraucht haben. Clarkson war fasziniert und tat sich mit Cynthia Conklin, einer Forscherin zur Raucherentwöhnung an der University of Pittsburgh, zusammen, um mithilfe von Methoden aus der Raucherforschung zu untersuchen, wie Frauen mit überaktiver Blase auf persönliche Auslöser reagieren. Den Frauen wurden Bilder von Orten gezeigt, die bei ihnen Harndrang auslösten, etwa ihre Haustür oder der Eingang eines Supermarktes. Im Vergleich zu den „sicheren“ Fotos löste das Betrachten dieser Fotos eine erhöhte Aktivität in den Gehirnbereichen aus, die mit Aufmerksamkeit, Entscheidungsfindung und Blasenkontrolle in Verbindung stehen. Bestimmte Verhaltenstherapien scheinen Frauen mit überaktiver Blase zu helfen, auf dringende Auslöser ruhiger zu reagieren, sagte Clarkson. So deuten die vorläufigen Daten ihres Teams beispielsweise darauf hin, dass Achtsamkeitstechniken wie die Body-Scan-Meditation die Teilnehmer dazu anregen können, sich von Kopf bis Fuß zu entspannen und die Intensität ihrer Blase zu reduzieren. Sie fanden außerdem heraus, dass eine nicht-invasive Form der Gehirnstimulation, die sogenannte transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS), das Dringlichkeitsgefühl lindern kann. © Tumblr Clarkson und ihr Team haben außerdem die Unterschiede in der Gehirnaktivität bei Frauen untersucht, die auf eine Behandlung mit Botox und Beckenbodenmuskeltherapie ansprachen bzw. nicht ansprachen. Derzeit untersuchen sie, ob die Einnahme häufig verschriebener Blasenmedikamente zu Veränderungen im Gehirn führen kann. Viele ältere Frauen und Männer, die sich wegen einer überaktiven Blase behandeln lassen, nehmen bereits mehrere anticholinerge Medikamente ein, darunter auch die am häufigsten verwendeten Blasenmedikamente, Antimuskarinika. Da die Einnahme zu vieler dieser Medikamente zu kognitiven Problemen führen kann, hofft Clarkson, die Behandlungsmöglichkeiten ohne Medikamente zu erweitern. „Wenn wir die Menschen von ihren Medikamenten entwöhnen könnten, wäre das großartig“, sagte sie. Ursachen einer überaktiven Blase Die meisten Forscher sind sich einig, dass das Haupthindernis für die Entwicklung wirksamerer Behandlungsmethoden für die überaktive Blase darin liegt, dass die Diagnose so vage ist: Es handelt sich nicht um eine einzelne Krankheit, sondern um eine lose Aneinanderreihung von Symptomen, die viele verschiedene Ursachen haben können, von der Parkinson-Krankheit über Rückenmarksverletzungen bis hin zu Diabetes oder keiner der oben genannten Ursachen. Doch diese Fälle würden oft in einen Topf geworfen und so behandelt, als handle es sich bei allen um dieselbe Krankheit, sagt Aaron Mickle, Neurowissenschaftler am Medical College of Wisconsin. Meeker untersucht, wie sich unterschiedliche Bedingungen auf die Auskleidung der Blase, das Urothel, auswirken – eine weiche, sich selbst erneuernde Gewebeschicht, die sich dehnt und abflacht, um Veränderungen der Blasenkapazität auszugleichen. Obwohl Wissenschaftler früher dachten, das Urothel sei eine passive Barriere, die ein Auslaufen der Blasenwand verhindert, ist heute klar, dass es eine Schlüsselrolle bei der Signalisierung der Blasenfüllung spielt. Ein Grund für die hohe Empfindlichkeit des Urothels liegt darin, dass viele seiner Zellen mehrere Arten mechanisch aktivierter Ionenkanäle enthalten – Proteine, die auf der Zellmembran sitzen und tatsächlich Tore in die Zelle darstellen. Kate Poole, Physiologin an der University of New South Wales in Australien und Autorin eines Artikels aus dem Jahr 2022 über mechanisch aktivierte Ionenkanäle bei Säugetieren im Annual Review of Physiology, erklärt, dass sich diese Kanäle öffnen, wenn die Zellmembran gedehnt, gedrückt oder anderweitig verformt wird, wodurch positiv geladene Ionen in die Zelle strömen können.[4] Sensorische Neuronen, die sich bis zum Urothel erstrecken, enthalten diese kraftempfindlichen Kanäle; Wenn der Zustrom positiver Ionen in diese Nerven einen bestimmten Schwellenwert erreicht, kommunizieren sie über elektrische Impulse direkt mit Nerven in der Wirbelsäule und im Gehirn. Interessanterweise enthalten jedoch auch nicht-neuronale Zellen im Urothel eine Vielzahl mechanisch aktivierter Ionenkanäle, was darauf hindeutet, dass sie auch die Blasenfüllung signalisieren können. Im Jahr 2023 stimulierte Aaron Mikkel selektiv einige nicht-neuronale Urothelzellen mithilfe der Optogenetik (Fernaktivierung oder -deaktivierung ausgewählter Zellen in einem Tier mithilfe eines Laserstrahls). Dies reichte aus, um sensorische Neuronen zu aktivieren und Blasenkontraktionen auszulösen. Dies war das erste Mal, dass dies erfolgreich gelang. Mikkel hofft, irgendwann ein drahtloses optogenetisches System entwickeln zu können, das die Aktivität bestimmter Arten von Blasenzellen im menschlichen Körper kontinuierlich überwachen und modulieren kann. (Obwohl die Optogenetik derzeit hauptsächlich bei Labortieren eingesetzt wird, untersuchen Forscher ihre Anwendung beim Menschen.) Andere Forschungsgruppen untersuchen kraftempfindliche Kanäle in Blasenzellen als Angriffspunkte für Medikamente sowie andere Kanäle, die auf verschiedene Nervensignalchemikalien und Hormone reagieren. Zu diesen Kanälen gehört eine Gruppe kraftempfindlicher spiralförmiger Proteine, sogenannte Piezokanäle, die eine wichtige Rolle bei der Blasenwahrnehmung spielen. Im Jahr 2020 zeigte eine in der Fachzeitschrift Nature[5] veröffentlichte Studie, dass Menschen mit einer seltenen Mutation, die einen Kanal namens Piezo2 betrifft, neben anderen schwerwiegenden Defekten wie Gehschwierigkeiten auch Probleme damit haben, eine volle Blase zu spüren. Manche Menschen müssen nach einem festen Zeitplan urinieren oder manuell auf ihre Blase drücken, um sie zu entleeren. Der dreizackige, propellerförmige Piezo2-Kanal ist einer von mehreren kraftempfindlichen Proteinkanälen in der Blase und sitzt auf der Zellmembran. Es öffnet sich durch mechanische Kräfte wie Zug und Druck. Kürzlich stellten Forscher fest, dass sowohl Menschen als auch Ratten mit Genmutationen, die die Funktion von Piezo2 beeinträchtigen, Probleme beim Wasserlassen haben. Zu diesen Beeinträchtigungen gehört eine verminderte Fähigkeit, zu spüren, wann die Blase voll ist oder überläuft. © GOULTARD59 / WIKIMEDIA COMMONS Einige Wissenschaftler hoffen, Piezo2-Kanäle gezielt zur Behandlung verschiedener Blasenerkrankungen einsetzen zu können. Ein Vorteil der gezielten Ansteuerung dieser Kanäle liege darin, dass sie „von Haus aus medikamentös behandelbar“ seien, so Poole. Das bedeutet, dass Forscher oft kleine Moleküle finden können, die sie ein- oder ausschalten können, selbst wenn sie normalerweise auf mechanische Stimulation reagieren. Allerdings gibt es einen Nachteil: Wie andere Ionenkanäle, die die Forscher in der Blase gezielt ansteuern wollten, kommen Piezo2-Kanäle im gesamten Körper vor, unter anderem in der Lunge, den Gelenken und im Herzen. Daher kann jedes Medikament, das die Passagen in der Blase beeinflusst, auch andere Teile des Körpers beeinträchtigen, was Sicherheitsbedenken aufwirft. Michel weist darauf hin, dass ein Medikament, das auf einen anderen Typ von Ionenkanälen in der Blase wirkt (diese Kanäle ermöglichen den Eintritt von Kaliumionen in die Zellen), einmal in klinischen Studien getestet wurde. Die Studie musste jedoch abgebrochen werden, weil festgestellt wurde, dass das Medikament Leberprobleme verursacht. Derzeit gibt es zumindest theoretisch eine Möglichkeit, dieses Hindernis zu überwinden: Gentherapien, die speziell auf das Blasengewebe abzielen, wie es sie bereits gibt, werden entweder direkt in den Detrusormuskel injiziert oder über einen Katheter in die Harnröhre. Im Jahr 2023 veröffentlichten Wissenschaftler vorläufige, aber ermutigende Daten aus einer Studie mit 67 Patienten, die eine Gentherapie für den Kaliumkanal in der Blase erhielten. Von links nach rechts: Normale Blase im leeren Zustand; Normale Blase bei voller Füllung (Harndrang bei voller Blase); Überaktive Blase (Drang zum Harnlassen, auch wenn die Blase fast leer ist). © AARE Urocare Obwohl Wissenschaftler, die sich mit der Untersuchung der Blase und der Harnwege befassen, traditionell getrennt von denen arbeiteten, die sich mit dem Rückenmark und dem Gehirn befassen, beginnen diese lange getrennten Fachgebiete nun zusammenzuarbeiten, um weitere Teile des Gehirn-Blasen-Puzzles zusammenzusetzen. So hat sich Meikle beispielsweise vor Kurzem mit einem Labor für Neurobildgebung zusammengetan, das ihm dabei helfen wird, die Reaktion des Mäusegehirns auf die optogenetische Stimulation seiner Urothelzellen zu beobachten. „In der Vergangenheit haben wir dem Gehirn nie Beachtung geschenkt“, sagte Valentino. Sie sagte jedoch, die neue Forschung „bringt uns dazu, mehr über diese anderen Ziele nachzudenken.“ Quellen: [1]www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev.pharmtox.41.1.691[2]onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/nau.24559 [2]www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-pharmtox-010617-052615 [4]www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-physiol-060721-100935 [5]www.nature.com/articles/s41586-020-2830-7 Von Emily Underwood Übersetzt von Tim Korrekturlesen/tamiya2 Originalartikel/www.smithsonianmag.com/science-nature/how-do-we-know-when-to-pee-180984448/ Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von Tim auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
<<: Vortrag über populärwissenschaftliches Wissen zur Vorbeugung von Brucellose
>>: Hä? Warum „expandieren“ sich Kartoffeln jetzt…
Artikel empfehlen
Wie viele Kilogramm Fritillaria pro mu
Fritillaria-Ertrag pro mu Normalerweise beginnt d...
#千万IP创科学热门# Wie kann man einer koronaren Herzkrankheit vorbeugen? Ein paar Tipps, die ich Ihnen verraten möchte | Wissenschaftspopularisierung im Silbernen Zeitalter
Anmerkung des Herausgebers Seit dem letzten Jahr ...
Lammleberbrei
Erinnern Sie sich noch an einige Erkenntnisse zum...
Der Nährwert von Sojasprossen und die Vorteile des Verzehrs von Sojasprossen
Sojasprossen werden hauptsächlich aus Sojabohnen ...
Wann sollte man Hortensien nach der Blüte beschneiden? Schnittmethoden und Vorsichtsmaßnahmen nach der Blüte
Es ist tatsächlich wichtig, Hortensien nach der B...
Wie stellt man Granatapfelwein her? Welche Vorteile bietet Granatapfelwein?
Granatäpfel hat bestimmt jeder schon einmal geges...
Bist du wirklich nicht dick? Ist es möglich, dass Sie ein „unsichtbarer Dicker“ sind?
Aussage: Bei diesem Artikel handelt es sich um ei...
Wie hoch ist der durchschnittliche Sonnenblumenertrag pro Hektar? Die Kosten und der Nettoertrag des Sonnenblumenanbaus pro Hektar
Sonnenblumenertrag pro mu Aufgrund des hohen wirt...
Der Nährwert von Reisbohnen
Reisbohnen, auch als rote Bohnen bekannt, können ...
Die Wirksamkeit, Wirkungen und Tabus der faulen Kaki
Die faule Kaki ist eine Obstsorte, die häufig geg...
Kann Krebs zwischen Paaren ansteckend sein? Diese 4 Arten von „Paarkrebs“ können leicht auftreten, treffen Sie Vorkehrungen →
Tratsch „Kann Krebs zwischen Mann und Frau übertr...
Kann man Holzäpfel im Garten pflanzen?
Kann ich im Garten Holzäpfel pflanzen? Begonien k...
Kann Wassermelone beim Abnehmen helfen? Warum kann der Verzehr von Wassermelone beim Abnehmen helfen?
Was soll man abends essen? Macht der Verzehr von ...
Wie ist die Oxford Brookes University? Oxford Brookes University Bewertungen und Website-Informationen
Wie lautet die Website der Oxford Brookes Universi...
Ist Clematis für tiefe oder flache Töpfe geeignet?
Sollte ich für Clematis einen tiefen oder flachen...