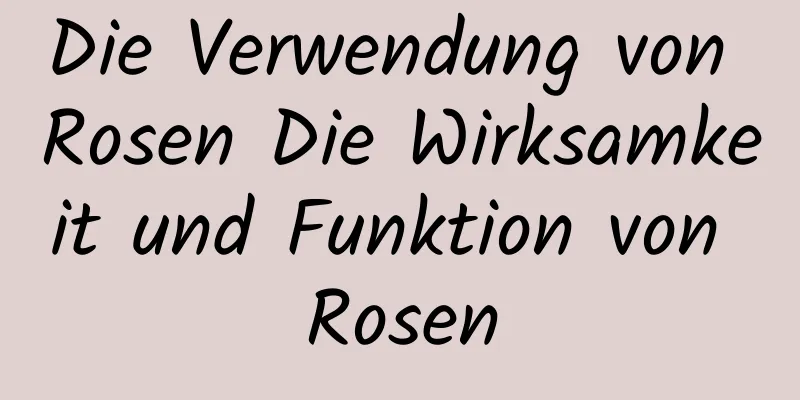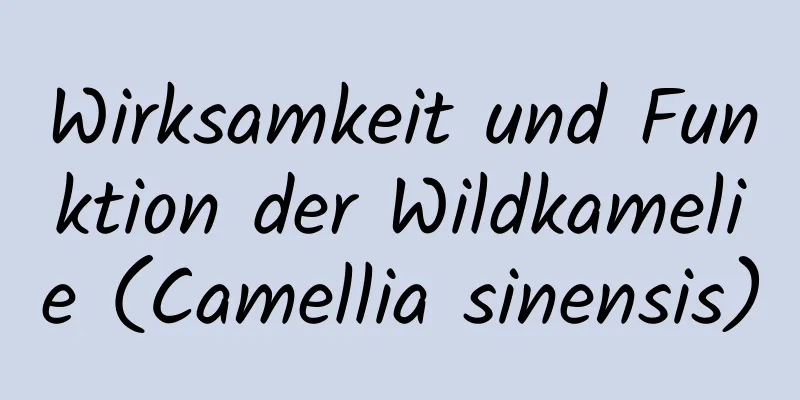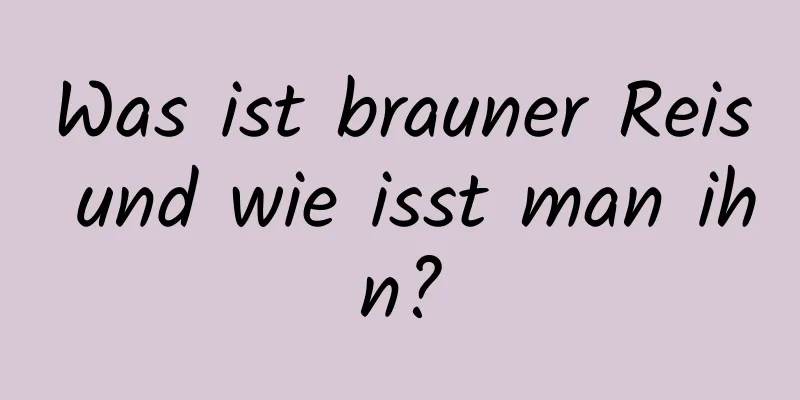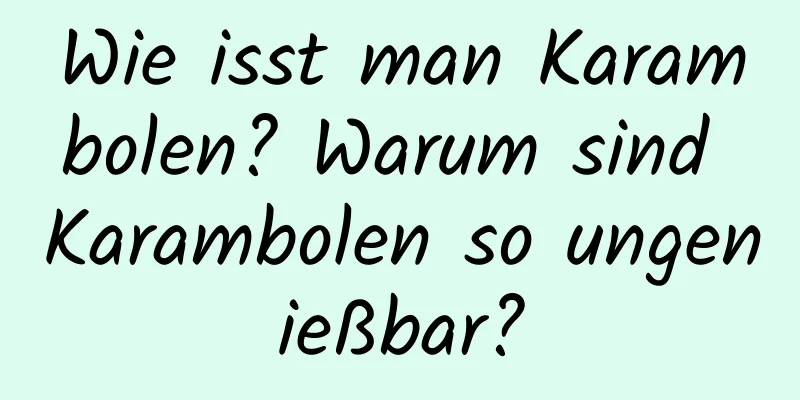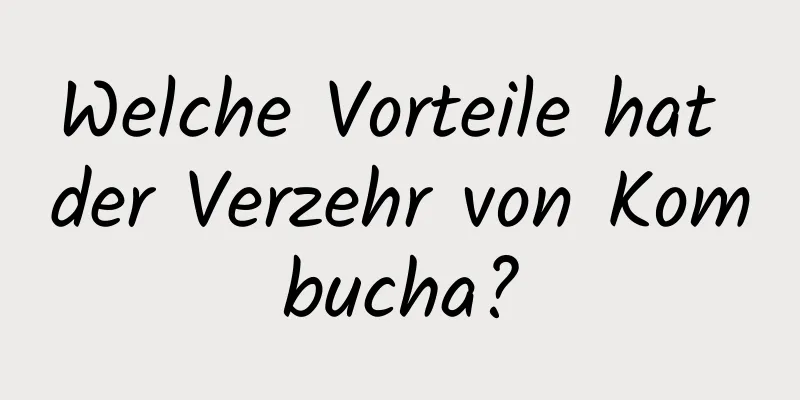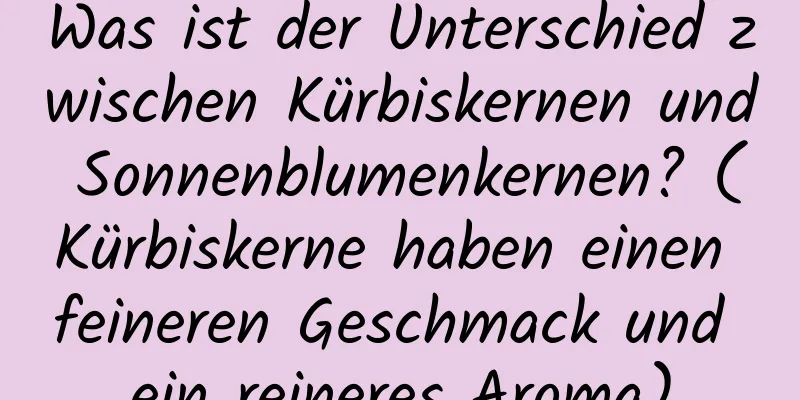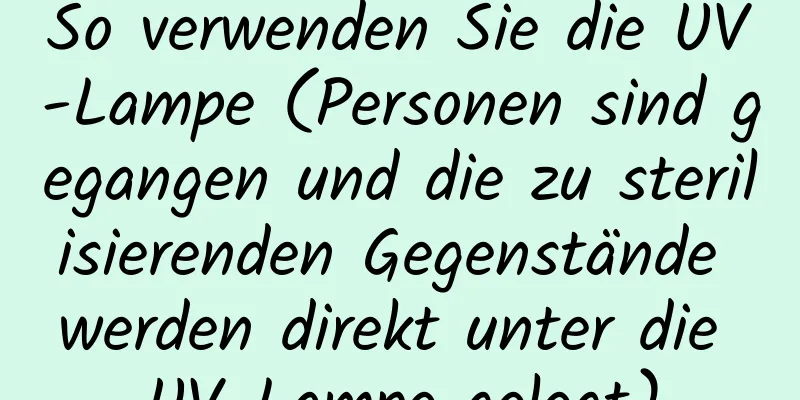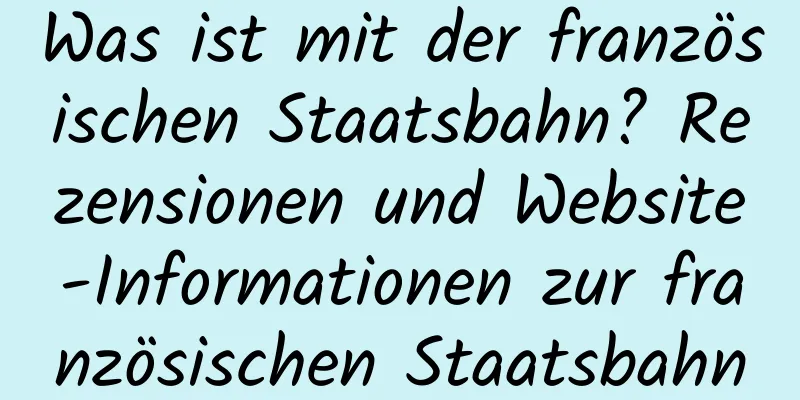Gibt es bei einer Urämie keinen Ausweg?

|
Bei Herrn Li, 43 Jahre alt, wurde bei einer körperlichen Untersuchung vor 7 Jahren leicht erhöhter Blutdruck und erhöhter Eiweißgehalt im Urin festgestellt. Seine Nierenfunktion war zu diesem Zeitpunkt normal und der Arzt diagnostizierte bei ihm eine chronische Nephritis. Da die Symptome damals nicht offensichtlich waren, nahm Herr Li sie nicht ernst und erhielt keine formelle Behandlung. Bei einer körperlichen Untersuchung vor zwei Jahren wurde festgestellt, dass der Kreatininwert im Blut 268 μmol/l und der Blutdruck 190/120 mmHg (25,3/16,0 kPa) betrug. Da es noch immer keine offensichtlichen Beschwerden gab, schenkte Herr Li dem noch immer keine Beachtung. Seitdem nimmt er zeitweise blutdrucksenkende Medikamente ein. Sein Blutdruck beträgt im Allgemeinen (150~170)/(90~100) mmHg [(20,0~22,6)/(12,0~13,3) kPa]. Außerdem nimmt er zeitweise chinesische Medizin zur „Nierenschutzbehandlung“ ein. Im letzten Monat litt er unter Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, generalisierten Ödemen, Engegefühl in der Brust, der Unfähigkeit, nachts flach zu liegen, und einer verringerten Urinausscheidung. Er ging zur Untersuchung ins Krankenhaus, wo sich herausstellte, dass sein Kreatininspiegel im Blut bei fast 1000 μmol/l und sein Harnstoffstickstoffspiegel bei 38 mmol/l lag. Der Arzt sagte, er habe Urämie. Herr Li war schockiert, als er das hörte. Er wurde pessimistisch und enttäuscht und dachte, dass er nicht mehr viele Tage leben würde. Gibt es also keinen Ausweg für die Urämie? Kontrolle der Grunderkrankungen und Verschlimmerung des chronischen Nierenversagens Einige Grunderkrankungen, die eine Urämie verursachen, sind nach der Behandlung reversibel. Auch wenn sich die Nierenerkrankung nur geringfügig bessert, kann sich die Nierenfunktion in unterschiedlichem Ausmaß verbessern. Wenn beispielsweise bei einer durch Lupusnephritis verursachten Urämie die Nierenbiopsie zeigt, dass die Läsionen mäßig chronisch sind und der Aktivitätsindex hoch ist, verbessert sich die Nierenfunktion nach der Behandlung. Darüber hinaus kann die Nierenfunktion auch durch die Korrektur bestimmter reversibler Faktoren verbessert werden, die das Nierenversagen verschlimmern. Zu diesen Faktoren zählen die folgenden Aspekte. (1) Die primäre Nierenerkrankung ist nicht gut kontrolliert, wie z. B. verschiedene Nephritis-Aktivitäten, Bluthochdruck und schlecht kontrollierter Diabetes. (2) Unzureichendes Blutvolumen, wie Erbrechen, Durchfall oder starke Diurese, was zu Dehydration, starken Blutungen, Hypotonie usw. führen kann. Im Fall von Herrn Li kann der Grund für die kurzfristige Verschlechterung seiner Nierenfunktion mit der durch Erbrechen und Durchfall verursachten Dehydration zusammenhängen. (3) Schwere Hypertonie, die nicht kontrolliert wird, insbesondere wenn der Blutdruck über 180/120 mmHg (24,0/16,0 kPa) bleibt. (4) Herzinsuffizienz oder schwere Herzrhythmusstörungen. (5) Verwendung nephrotoxischer Arzneimittel wie bestimmter Antibiotika, Analgetika, Kontrastmittel und traditioneller chinesischer Arzneimittel, die Aristolochiasäure enthalten. (6) Harnwegsobstruktion, wie Harnsteine, Prostatahypertrophie usw. (7) Verschiedene Infektionen, einschließlich Infektionen der Atemwege, des Verdauungstrakts, der Harnwege oder der Haut. Einerseits können bakterielle Infektionstoxine die Nierentubuli direkt schädigen; Andererseits können durch Infektionen bedingte Wasser- und Elektrolytstörungen oder Kreislaufversagen die Nierenschädigung verschlimmern. (8) Elektrolytstörungen, wie Hyperkalzämie oder Hyperphosphatämie. (9) Akute Stresszustände wie Traumata, größere Operationen usw. Verlangsamung des Fortschreitens chronischer Nierenerkrankungen Durch eine ganzheitliche Behandlung kann das Fortschreiten einer chronischen Nierenerkrankung verlangsamt werden. 1. Diättherapie (1) Proteinarme Ernährung: Eine proteinarme Ernährung kann die Symptome einer Urämie verzögern, es ist jedoch notwendig, die Ernährung mit zusammengesetzten α-Ketosäurepräparaten zu ergänzen und auf die Überwachung des Nährwertindex zu achten, um eine Unterernährung zu vermeiden. Seit bei Tante Wang Urämie diagnostiziert wurde, isst sie fast keine proteinreichen Nahrungsmittel mehr, wie Hühnchen, Eier, Fleisch und Fisch, und sie isst auch sehr wenig Reis und Nudeln. Bei einer erneuten Kontrolle einen Monat später war der Kreatininspiegel im Blut tatsächlich gesunken. Tante Wang war sehr ermutigt und achtete weiterhin auf ihre Ernährung. Doch schon bald magerte Tante Wang merklich ab, ihre körperliche Kraft ließ deutlich nach und sie erkrankte häufig an Erkältungen und Fieber. Was ist der Grund dafür? Durch die Einschränkung des Proteinkonsums verringerte Tante Wang die Produktion von Protein-Stoffwechselabfällen im Körper, verringerte jedoch auch die Synthese von Proteinen, die für die menschlichen Lebensaktivitäten benötigt werden, was zu Unterernährung und einer verringerten Widerstandskraft des Körpers führte. Der Arzt empfahl ihr daher, ihre Ernährung mit komplexen α-Ketosäurepräparaten zu ergänzen und gleichzeitig ihre Proteinzufuhr zu reduzieren. Nach dem Eintritt in den menschlichen Körper kann das zusammengesetzte α-Ketosäurepräparat durch eine Reihe von Reaktionen mit dem durch den Stoffwechsel im Körper produzierten Abfallammoniak Protein synthetisieren, wodurch nicht nur der Harnstoffstickstoffspiegel im Blut gesenkt und die Symptome der Urämie gelindert werden, sondern auch Protein ergänzt wird, wodurch ein besserer Ernährungszustand für Urämiepatienten aufrechterhalten wird. (2) Kalorienaufnahme: Durch die Aufnahme von ausreichend Kohlenhydraten, um den Körper mit ausreichend Kalorien zu versorgen, wird der Abbau von Proteinen zur Bereitstellung von Kalorien verringert und der Verbrauch der Proteinreserven im Körper verringert. Die Kalorienaufnahme muss bei 125–146 kJ/(kg Tag) gehalten werden. Betroffene Patienten können etwas Mehl mit geringerem Proteingehalt essen. Übergewichtige Patienten müssen ihre Kalorienzufuhr entsprechend einschränken (die Gesamtkalorienaufnahme kann im Vergleich zur oben empfohlenen Menge um 1046–2092 kJ/Tag reduziert werden), bis sie ihr Standardgewicht erreichen. Wenn Patienten weniger essen, können sie beim Kochen Zucker und Pflanzenöl hinzufügen, um ihre Kalorienzufuhr zu decken. (3) Kalium- und Natriumzufuhr: Sie sollte flexibel entsprechend dem Ödemzustand und den medizinischen Bedürfnissen des Patienten gesteuert werden. Bei einer Hyperkaliämie ist beim Verzehr von Obst und Gemüse Vorsicht geboten. Um beim Kochen einen Teil des Kaliums zu entfernen, können die Früchte und Gemüse in großen Mengen Wasser gekocht werden. Die Menge der Natriumaufnahme hängt vom Grad des Ödems des Patienten ab. Bei Natriumretention sollte die Salzdiät eingeschränkt werden, es gilt jedoch zu beachten, dass „zu viel genauso schädlich ist wie zu wenig“. Manche Patienten mit Urämie geben zu keinem Gericht Salz oder Sojasauce hinzu. Bald entwickeln sie allgemeine Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Übelkeit und Schläfrigkeit. Als sie zur Untersuchung ins Krankenhaus gehen, stellen sie fest, dass ihr Natriumspiegel im Blut deutlich gesunken ist. Wenn dies nicht rechtzeitig korrigiert wird, kann es in schweren Fällen lebensbedrohlich sein. (4) Vitaminzufuhr: Essen Sie ausreichend frisches Obst und Gemüse, um genügend Vitamine zu sich zu nehmen. (5) Trinkwasser: Menschen mit Oligurie, Ödemen und Herzinsuffizienz sollten ihre Wasseraufnahme streng kontrollieren. Bei Personen mit einem Urinvolumen von >1000 ml und ohne Ödeme sollte die Wasseraufnahme jedoch nicht eingeschränkt werden. (6) Weitere Vorsichtsmaßnahmen: Patienten mit Hyperurikämie sollten die Aufnahme purinreicher Nahrungsmittel einschränken. Um den Phosphor- und Puringehalt von Lebensmitteln zu minimieren, können Sie mageres Fleisch und Hühnerfleisch vor dem Verzehr blanchieren. Bei Patienten mit erhöhten Blutfettwerten sollten verschiedene Nahrungsmittel bei der Zubereitung möglichst viel gekocht oder gedämpft, weniger gebraten und Frittieren möglichst vermieden werden. Tierische Innereien, Fischrogen, Schweinehirn etc. sollten nicht verzehrt werden. Mithilfe des oben beschriebenen Ernährungsbehandlungsplans können die Symptome einer Urämie bei den meisten Patienten gelindert werden. Patienten, die mit der Dialyse begonnen haben, sollten auf eine Dialysediät umstellen. 2. Effektive Blutdruckkontrolle: Der Blutdruck sollte unter 130/85 mmHg (17,3/11,3 kPa) gehalten werden. Die Verwendung von Angiotensin-Converting-Enzym-Hemmern und/oder Angiotensin-I-Rezeptorblockern wird empfohlen, da sie den hohen Druck im Glomerulus direkt senken, das Eiweiß im Urin reduzieren, die Entzündungsreaktion und Sklerose der Nierengewebezellen hemmen und so den Rückgang der Nierenfunktion verzögern können. Patienten mit Niereninsuffizienz sollten bei der Einnahme dieser Medikamente besonders vorsichtig sein, da diese Medikamente den Hyperfiltrationszustand der restlichen Glomeruli verringern und zu einer weiteren Verschlechterung der Nierenfunktion führen können. Es kommt zu einem leichten bis mäßigen Anstieg (10–30 %) des Kreatininspiegels im Blut, ein Absetzen des Arzneimittels ist jedoch nicht erforderlich. Bei einem weiteren Anstieg des Kreatininspiegels im Blut oder gar einer Hyperkaliämie muss die Behandlung mit dem ACE-Hemmer und/oder dem Angiotensin-I-Rezeptorblocker abgesetzt und durch andere blutdrucksenkende Medikamente ersetzt werden. 3. Lipidsenkende Behandlung: Die Behandlung der Hyperlipidämie erfolgt wie bei allgemeiner Hyperlipidämie und sollte aktiv erfolgen. 4. Behandlung mit traditioneller chinesischer Medizin: Die traditionelle chinesische Medizin hat eine lange Geschichte und ist tiefgreifend und verfügt über beträchtliche Erfahrungen in der Behandlung von Nierenerkrankungen. Die schützende Wirkung verschiedener chinesischer Kräuterheilmittel auf die Nierenfunktion hat weltweite Aufmerksamkeit erregt, beispielsweise Cordyceps sinensis und Rhabarber. Rhabarber wirkt abführend und fördert die Darmentgiftung; Cordyceps sinensis hat antioxidative Wirkungen, hemmt Nierenfibrose und verzögert das Fortschreiten von Nierenerkrankungen. Natürlich ist die chinesische Medizin nicht völlig harmlos. Studien haben bestätigt, dass einige chinesische Arzneimittel nephrotoxische Wirkungen haben. Belgien berichtete beispielsweise einmal über eine „Behandlung von Nierenerkrankungen durch chinesische Medizin, und spätere Studien ergaben, dass dies mit den Nebenwirkungen von Akebia zusammenhing.“ Deshalb sollten wir medizinische Behandlung auf wissenschaftlicher Grundlage anstreben, es vermeiden, im Krankheitsfall überstürzt medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, nicht blind an „Volksheilmittel“ oder „Geheimrezepte“ glauben, Medikamente nicht leichtfertig einnehmen und bei der Einnahme chinesischer Medizin in ein normales Krankenhaus gehen, um ein Rezept zu bekommen und die Medikamente abzuholen. Patienten mit Urämie, die auf die oben genannte integrierte Behandlung nicht ansprechen oder bei denen bestimmte Komplikationen auftreten, benötigen eine Nierenersatztherapie. |
Artikel empfehlen
Der Nährwert von schwarzem Pilz und die Vorteile des Verzehrs von schwarzem Pilz
Schwarzer Pilz ist ein weit verbreitetes Pilznahr...
Welche Anbaumethoden und Vorsichtsmaßnahmen gibt es für Pfeilwurz?
Wuchsgewohnheiten der Pfeilwurz Pfeilwurz bevorzu...
Strategy Analytics: Im vierten Quartal 2021 wurden in Großbritannien 7,3 Millionen Mobiltelefone ausgeliefert, ein leichter Anstieg von 1 % im Vergleich zum Vorjahr.
Daten von Strategy Analytics zeigen, dass im vier...
Wie man fleischige lila Perlen züchtet und worauf man achten muss
Wuchsgewohnheiten der Purpurperle Die saftige Pur...
Die Verschönerung der Zähne kann nicht ignoriert werden. Ist Zahnreinigungspulver wirklich ein neuer Partner für die Zahngesundheit?
Da die Menschen ihren Gesundheitsfragen immer meh...
Die Wirksamkeit und Funktion von Kartoffeln
Kartoffeln sind ein weit verbreitetes Nahrungsmit...
Wann ist der richtige Zeitpunkt, Babys Beikost zu geben? Zeitplan für Babynahrungsergänzungsmittel
Wenn wir Mütter werden, möchten wir vom Moment de...
Wie kocht man Klebreisbällchen und Eier, damit sie köstlich werden? Was kann man zu Klebreisbällchen essen, um die Verdauung zu verbessern?
Klebreisbällchen stammen aus der Song-Dynastie. E...
So gießen Sie Gardenien nach dem Umtopfen
Gardenien-Bewässerungsübersicht Beim Gießen von G...
Welche Vorteile hat der Verzehr von grüner Kumquatsauce?
Grüne Kumquat-Marmelade ist eine der beliebtesten...
Wie man den Boden von Orangenbäumen verändert und wann und wie man den Boden verändert
Wann sollte der Boden von Orangenbäumen gewechsel...
Helfen! Die Pupille verwandelt sich plötzlich in ein Dreieck. Handelt es sich dabei um eine Folgeerscheinung des neuen Coronavirus? Die Wahrheit ist...
Vor ein paar Tagen postete jemand im Internet: „V...
Warum löst sich die Air Cushion BB Cream? Wie lange ist eine Cushion BB Cream haltbar?
Obwohl der Air Cushion Powder als Puder bezeichne...
Berühren die Brüste von Mädchen Jungen, wenn sie sie umarmen? Wie reagieren Mädchen, wenn ihre Brüste berührt werden?
Wenn ich meinen Freund umarme, habe ich immer Ang...
Wann ist Matsutake in der Saison erhältlich? Wie man Matsutake isst
Matsutake, auch Kiefernpilz, Mischling und Taiwan...