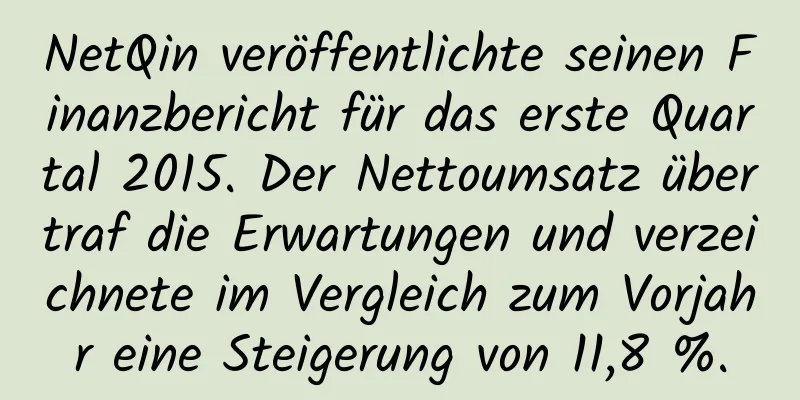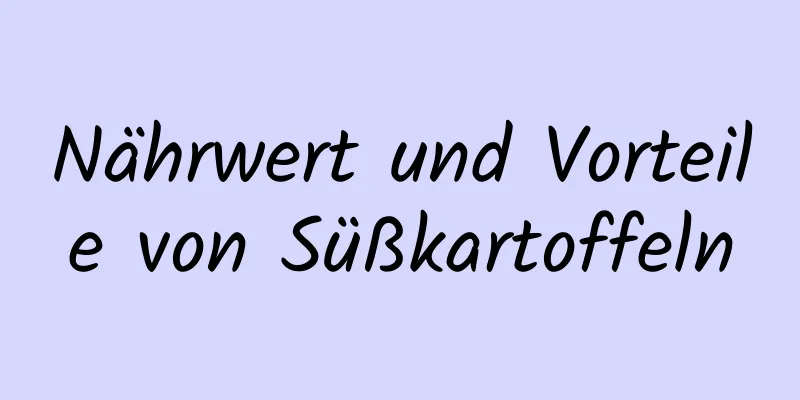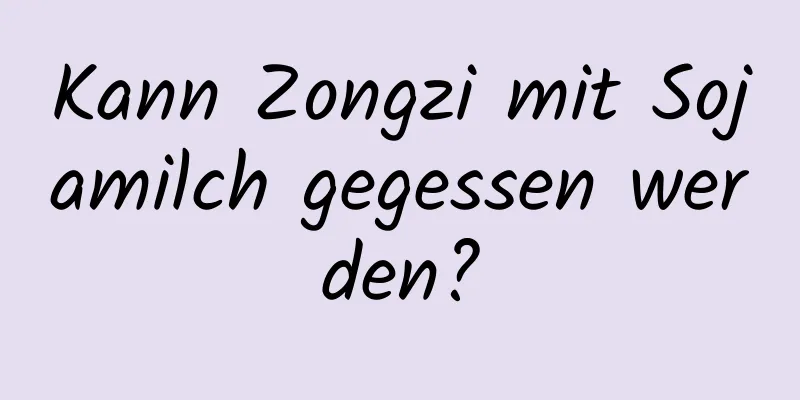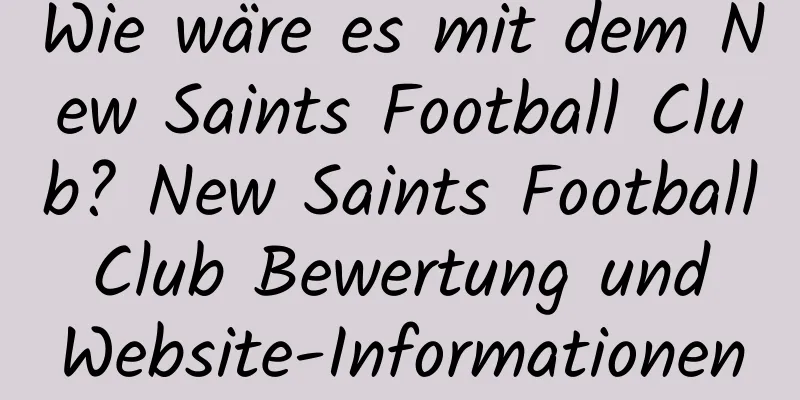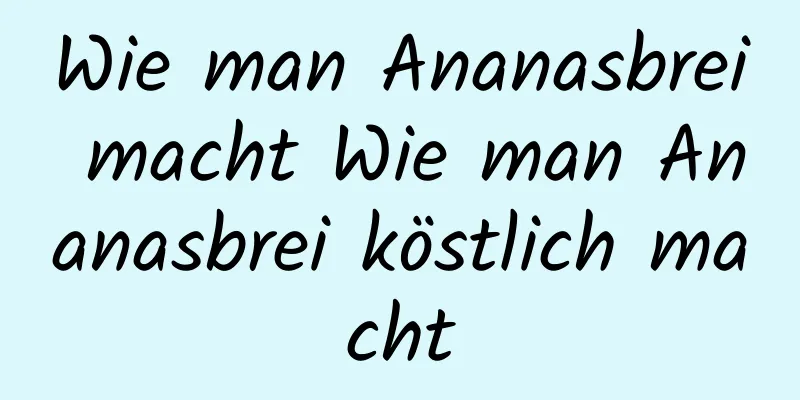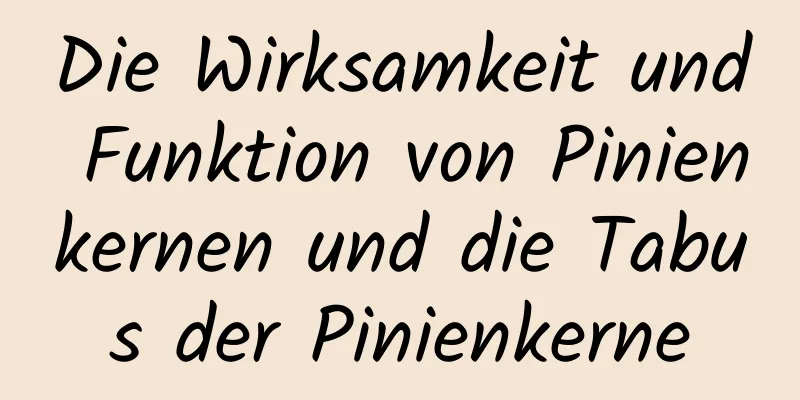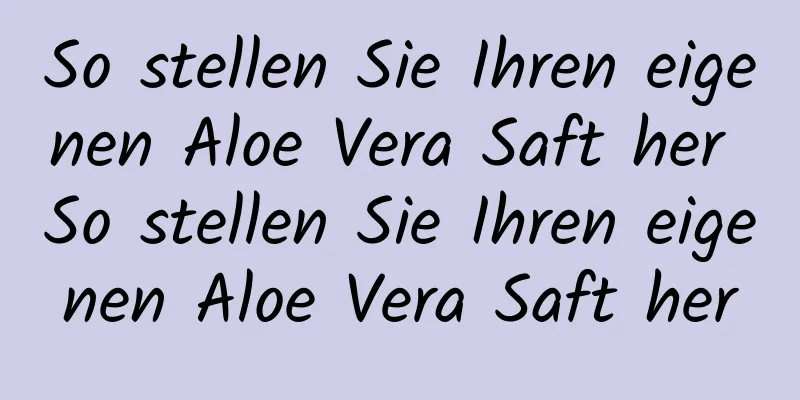Haben Sie eine Opfermentalität?
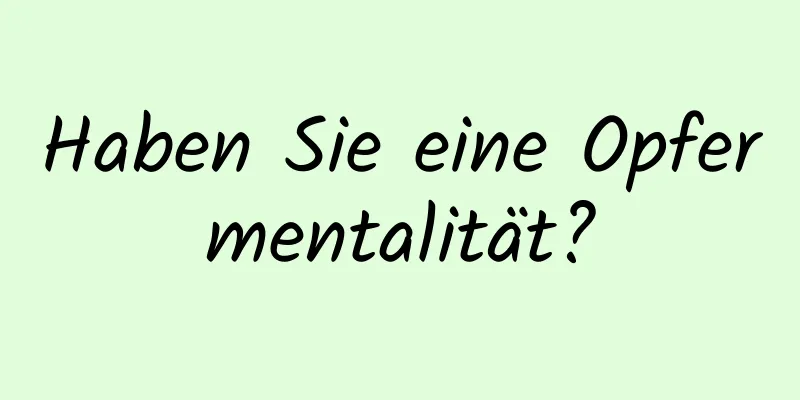
|
Leviathan Press: In diesen Tagen habe ich zufällig die Nachricht gesehen, dass Zhu, der Verbrecher im „Fall der Frauentötung und Leichenversteckung in Shanghai“, letzten Monat hingerichtet wurde. Auf die Einzelheiten des Falles werde ich hier nicht näher eingehen. Interessierte können selbst nach entsprechenden Berichten suchen. Was mich interessiert, ist, wie viele Punkte Zhu bekommen würde, wenn er die folgende Frage zur „zwischenmenschlichen Opfertendenz“ beantworten würde – tatsächlich lässt sich aus den Medienberichten und seinem Geständnis unschwer erkennen, dass sich Zhus mangelnde Wahrnehmung des Schmerzes anderer Menschen (Empathie) deutlich in ihm widerspiegelt, und auch die Doppelmoral-Logik von Zhus Mutter bei der Verteidigung ihres Sohnes nach dem Vorfall ist sprachlos und schockierend. Die „Opfermentalität“ in diesem Artikel betrifft oft diejenigen, die anderen Schaden zufügen, ohne es zu merken. Darüber hinaus haben sie oft das Gefühl, dass ihre „guten Taten“ nicht verstanden werden, was zu dem Gefühl führt, dass „die anderen mir etwas schulden“. Die Manifestation dieser ängstlich abhängigen Persönlichkeit ist voller Widersprüche, aber ihre innere Logik ist ein in sich geschlossener Kreislauf – daher wird sie zu einer „unscheinbaren Person“. Wichtiger ist mir, dass die Person, die mich verletzt hat, erkennt, dass ich ungerecht behandelt wurde. Wenn Sie bei allen diesen Fragen hohe Werte (4 oder 5) erreichen, leiden Sie möglicherweise unter einer Tendenz zur zwischenmenschlichen Opferrolle, wie Psychologen es nennen. Soziale Ambiguität Das gesellschaftliche Leben ist immer mehrdeutig. Ihr Date antwortet möglicherweise nicht auf Ihre Textnachricht; Ihre Freunde lächeln möglicherweise nicht zurück, wenn Sie sie anlächeln. und Fremde haben manchmal einen unglücklichen Gesichtsausdruck. Die Frage ist: Wie interpretieren Sie diese Situationen? Glauben Sie, dass sich das alles gegen Sie richtet? Oder ziehen Sie wahrscheinlichere Szenarien in Betracht, beispielsweise dass Ihr Freund einfach einen schlechten Tag hat, Ihr neues Date zwar noch Interesse zeigt, aber versucht, cool zu bleiben, und der Fremde auf der Straße sich über irgendetwas aufregt und Ihre Existenz nicht einmal bemerkt? Während die meisten Menschen diese sozialen Ambiguitäten relativ leicht überwinden können, indem sie ihre Emotionen regulieren und akzeptieren, dass sie ein unvermeidlicher Teil des sozialen Lebens sind, neigen manche Menschen dazu, sich selbst als ewige Opfer zu sehen. Rahav Gabay und ihre Kollegen definieren zwischenmenschliche Viktimisierung als „ein anhaltendes Gefühl, Opfer zu sein, das sich über mehrere Beziehungen erstreckt. Dadurch wird die Viktimisierung zu einem zentralen Bestandteil der Identität des Einzelnen.“ Menschen mit einer ständigen Opfermentalität neigen dazu, einen „externen Kontrollort“ zu haben. Sie glauben, dass das Leben eines Menschen völlig äußeren Kräften unterworfen ist, wie etwa dem Schicksal, dem Glück oder der Gnade anderer. (www.researchgate.net/publication/341548585_The_Tendency_for_Interpersonal_Victimhood_The_Personality_Construct_and_its_Consequences) Durch klinische Beobachtung und Forschung haben Forscher herausgefunden, dass es vier Hauptaspekte zwischenmenschlicher Opfertendenzen gibt: a) ständiges Streben nach Anerkennung als Opfer; (b) moralischer Elitismus; (c) Mangel an Empathie für das Leid anderer; (d) Häufiges Grübeln über frühere Opfererfahrungen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Forscher das Erleben eines Traumas nicht mit einer Opfermentalität gleichsetzen. Sie weisen darauf hin, dass sich eine Opfermentalität entwickeln kann, ohne dass man ein schweres Trauma oder einen schweren Schaden erleidet. Umgekehrt bedeutet das Erleben eines schweren Traumas oder einer Viktimisierung nicht unbedingt, dass eine Person eine Opfermentalität entwickelt. Opfermentalität und Opferverhalten haben jedoch ähnliche psychologische Prozesse und Folgen. Darüber hinaus sind die vier von Experten identifizierten Merkmale der Opfermentalität auf der individuellen Ebene angesiedelt (die Forschungsergebnisse stammen aus einer Stichprobenstudie unter israelischen Juden). Daher sind die Ergebnisse möglicherweise nicht unbedingt auf Gruppenebene anwendbar. Es gibt jedoch Literatur, die nahelegt, dass die beiden Opfermentalitäten auf kollektiver Ebene einige bemerkenswerte Ähnlichkeiten aufweisen (wie ich weiter unten erläutern werde). Unter Berücksichtigung dieser Vorbehalte wollen wir uns nun die Hauptmerkmale der ewigen Opfermentalität genauer ansehen. Opfermentalität Ständig auf der Suche nach Anerkennung als Opfer. Menschen, die in diesem Bereich hohe Werte erzielen, haben ein ständiges Bedürfnis, dass ihr Schmerz anerkannt wird. Im Allgemeinen ist dies eine normale psychologische Reaktion auf ein Trauma. Das Erleben eines Traumas erfordert oft, dass wir unsere Annahme, die Welt sei ein gerechter und moralischer Ort, erschüttern. Sich die eigene Opferrolle einzugestehen, ist eine normale Reaktion auf ein Trauma und hilft einem Menschen, das Vertrauen zurückzugewinnen, dass die Welt ein fairer und gerechter Ort zum Leben ist. Darüber hinaus ist es für Opfer normal, dass sie von ihren Peinigern die Verantwortung für ihre Verfehlungen übernehmen und Schuldgefühle äußern. Untersuchungen, bei denen die Aussagen von Patienten und Therapeuten untersucht wurden, haben ergeben, dass die Anerkennung des Traumas des Patienten für die Genesung von Traumata und Viktimisierung wichtig ist. (www.researchgate.net/publication/15034528_Guilt_An_Interpersonal_Approach) Moralischer Elitismus. Wer in dieser Dimension hohe Werte erzielt, ist der Ansicht, dass er die moralische Überlegenheit besitzt und alle anderen unmoralisch sind. Moralischer Elitismus ermöglicht es, andere zu kontrollieren, indem man ihnen Unmoral, Ungerechtigkeit oder Egoismus vorwirft, während man sich selbst als „moralischen Kaiser“ betrachtet. (journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0533316414545707) Moralischer Elitismus entwickelt sich oft als Abwehrmechanismus gegen zutiefst schmerzhafte Emotionen und wird zu einer Möglichkeit, ein positives Selbstbild aufrechtzuerhalten. Dies führt dazu, dass Betroffene ihre eigenen aggressiven und destruktiven Impulse oft verleugnen und auf andere projizieren. Der „Andere“ wird als Bedrohung empfunden, während das Selbst als verfolgt, verletzlich und moralisch überlegen angesehen wird. (journals.sagepub.com/doi/10.1177/0533316414545843) Menschen, die die Welt in „Heilige“ und „Dämonen“ einteilen, schützen sich zwar möglicherweise vor Schmerz und einer Schädigung ihres Selbstbildes, doch diese Mentalität hemmt letztlich Wachstum und Entwicklung und ignoriert die Fähigkeit, die Komplexität unseres Selbst und der Gesellschaft zu erkennen. Mangelndes Einfühlungsvermögen für den Schmerz und das Leid anderer. Menschen, die in dieser Dimension hohe Werte erzielen, sind so auf ihre eigene Opferrolle fokussiert, dass sie blind für den Schmerz und das Leid anderer sind. Untersuchungen zeigen, dass Menschen, denen gerade Unrecht widerfahren ist oder die sich daran erinnern, dass ihnen in der Vergangenheit Unrecht widerfahren ist, sich berechtigt fühlen, aggressiv und egoistisch zu handeln, den Schmerz anderer zu ignorieren, sich selbst die Ehre zuzuschreiben und anderen keine Möglichkeit zur Gegenwehr zu geben. Emily Zitek und ihre Kollegen vermuten, dass solche Menschen möglicherweise das Gefühl haben, selbst genug gelitten zu haben, sodass sie sich nicht länger verpflichtet fühlen, sich um den Schmerz und das Leid anderer zu kümmern. Daher verpassen sie die Gelegenheit, anderen ihrer Art zu helfen. (pdfs.semanticsscholar.org/34ae/fcaa1b7f3c7ca7c968bbe5294bdf8d2e951d.pdf) Auf Gruppenebene zeigt die Forschung, dass eine erhöhte Aufmerksamkeit für Opfer innerhalb der Gruppe zu einer geringeren Empathie für rivalisierende Gruppen und unabhängige Gegner führt. Schon die bloße Andeutung einer Viktimisierung kann einen bestehenden Konflikt verschärfen. Diese Mentalität führt zu weniger Empathie für den Gegner. Die Menschen sind nicht bereit, eine kollektive Schuld großen Ausmaßes für die gegenwärtigen Schäden zu akzeptieren. Tatsächlich legt die Forschung zum Thema „Opferkonkurrenz“ nahe, dass Gruppenmitglieder, die in gewaltsame Konflikte verwickelt sind, dazu neigen, ihre Opfer als exklusiv anzusehen und den Schmerz und das Leid ihrer Gegner zu minimieren, abzuwerten oder schlichtweg zu leugnen. (www.jstor.org/stable/20447126) (journals.sagepub.com/doi/10.1177/1088868312440048) Wenn sich eine Gruppe ausschließlich auf ihr eigenes Leiden konzentriert, entwickelt sie das, was Psychologen als „Opferegoismus“ bezeichnen. Das heißt, die Mitglieder sind nicht in der Lage, die Dinge aus der Perspektive der rivalisierenden Gruppe zu sehen, können oder wollen kein Mitgefühl für deren Leiden zeigen und sind nicht bereit, Verantwortung für den Schaden zu übernehmen, den ihre eigene Gruppe anrichtet. Denken Sie häufig über frühere Opfererfahrungen nach. Wer in dieser Dimension hohe Werte erzielt, grübelt ständig über die Fehler nach, die er in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen macht, sowie über deren Ursachen und Folgen, statt über mögliche Lösungen nachzudenken oder diese zu diskutieren. Hierzu kann die Vorhersage zukünftigen aggressiven Verhaltens auf der Grundlage vergangenen aggressiven Verhaltens gehören. Untersuchungen zeigen, dass Opfer dazu neigen, über das ihnen widerfahrene zwischenmenschliche Unrecht nachzugrübeln. Dieses Grübeln verstärkt den Drang nach Rache und verringert dadurch den Drang, um Vergebung zu bitten. Auf der Gruppenebene der Analyse neigte die Opfergruppe dazu, häufig über ihre traumatischen Ereignisse nachzugrübeln. So hat beispielsweise die Häufigkeit von Holocaust-Materialien in den Lehrplänen jüdischer Schulen Israels, in kulturellen Produkten und im politischen Diskurs im Laufe der Jahre zugenommen. Obwohl die heutigen israelischen Juden im Allgemeinen keine direkten Opfer des Holocaust sind, sind die Israelis zunehmend besorgt über den Holocaust und haben Angst, dass sich etwas wiederholen könnte. (citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.882.1430&rep=rep1&type=pdf) Folgen einer Opfermentalität Bei zwischenmenschlichen Konflikten ist jede Partei motiviert, ein positives moralisches Selbstbild aufrechtzuerhalten. Daher ist es wahrscheinlich, dass unterschiedliche Parteien zwei völlig unterschiedliche subjektive Realitäten hervorbringen. Täter neigen dazu, die Schwere ihrer Straftaten herunterzuspielen, während Opfer dazu neigen, die Motive des Täters als willkürlich, dumm, unmoralisch und schwerwiegender anzusehen. Daher hat die Denkweise, die eine Person als Opfer oder Täter entwickelt, einen grundlegenden Einfluss darauf, wie Menschen Situationen wahrnehmen und sich daran erinnern. Gabay und ihre Kollegen identifizierten drei wichtige kognitive Verzerrungen, die zwischenmenschliche Viktimisierung charakterisieren: Interpretationsverzerrung, Attributionsverzerrung und Erinnerungsverzerrung. Alle drei Vorurteile können dazu führen, dass Menschen nicht bereit sind, anderen zu vergeben. Schauen wir uns diese Vorurteile genauer an. Erklärung der Voreingenommenheit Die erste Art der Interpretationsverzerrung betrifft die wahrgenommene Anstößigkeit sozialer Situationen. Die Forscher stellten fest, dass Menschen mit einer höheren Tendenz zur zwischenmenschlichen Viktimisierung sowohl Vergehen mit geringerer Schwere (wie etwa mangelnde Hilfsbereitschaft) als auch Vergehen mit hoher Schwere (wie etwa beleidigende Bemerkungen über ihre Integrität und ihren Charakter) als schwerwiegender einstuften. Die zweite Art der Interpretationsverzerrung betrifft die Erwartung von Schäden in mehrdeutigen Situationen. Die Forscher stellten fest, dass Menschen, die in ihren Beziehungen verletzlicher waren, auch eher glaubten, dass sich ein neuer Vorgesetzter in ihrer Abteilung nicht so sehr um sie kümmern würde oder nicht so bereit wäre, ihnen zu helfen, bevor sie ihn trafen. Zuschreibung schädlichen Verhaltens Personen mit zwischenmenschlichen Opfertendenzen neigten auch eher dazu, den Tätern negative Absichten zu unterstellen und nach dem Opferereignis stärkere und länger anhaltende negative Emotionen zu erleben. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit Untersuchungen, die zeigen, dass die Wahrnehmung der Menschen, ob eine Interaktion schädlich war, oft mit ihrer Wahrnehmung zusammenhängt, dass das schädliche Verhalten proaktiv war. Im Vergleich zu jenen, die bei zwischenmenschlichen Opfertendenzen niedrigere Werte erzielten, fühlten sich Menschen mit zwischenmenschlichen Opfertendenzen eher beleidigt, weil sie den Täter als böswilliger einschätzten. (journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093650205277319) Es wurde festgestellt, dass diese Voreingenommenheit auch auf kollektiver Ebene besteht. Die Sozialpsychologin Noa Schori-Eyal und ihre Kollegen stellten fest, dass Menschen, die auf einer Skala zur „permanenten In-Group-Opferorientierung“ höhere Werte erzielten – einer Skala, die die Überzeugung misst, sich zu unterschiedlichen Zeiten innerhalb der eigenen Gruppe ständig von verschiedenen Feinden schikaniert und verfolgt zu fühlen –, andere Gruppen eher als der eigenen Gruppe feindlich gegenüberstehen und schneller auf eine solche Kategorisierung reagierten (was darauf hindeutet, dass eine solche Kategorisierung eher automatisch erfolgt). Personen, die auf dieser Skala hohe Werte erzielen, neigen in unklaren Situationen auch eher dazu, anderen Gruppenmitgliedern böswillige Absichten zu unterstellen. Wenn sie an historische Gruppentraumata erinnert werden, neigen sie eher dazu, anderen Gruppen böse Absichten zu unterstellen. (www.researchgate.net/publication/317777288_Perpetual_ingroup_victimhood_as_a_distorted_lens_Effects_on_attribution_and_categorization) Bemerkenswert ist, dass es in ihrer Studie, obwohl die Mehrheit der Teilnehmer israelische Juden waren, immer noch erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Ausprägung der Opferorientierung innerhalb der Gruppe gab. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass jemand sich nicht unbedingt als Opfer sehen muss, nur weil er ein Opfer ist. Die Opfermentalität unterscheidet sich von der einer Person, die tatsächlich ein kollektives oder zwischenmenschliches Trauma erlebt hat, und es gibt viele Menschen, die dasselbe Trauma erlebt haben, sich jedoch weigern, sich als ständige Opfer innerhalb der Gruppe zu sehen. Gedächtnisverzerrung Menschen mit stärkeren zwischenmenschlichen Opfertendenzen weisen auch eine stärkere negative Erinnerungsverzerrung auf. Sie erinnerten sich an mehr Wörter, die aggressives Verhalten und verletzte Gefühle repräsentierten (wie etwa „Verrat“, „Wut“ und „Enttäuschung“) und erinnerten sich eher an negative Emotionen. Zwischenmenschliche Viktimisierungstendenzen waren nicht mit positiven Interpretationen, Zuschreibungen oder der Erinnerung an positive Emotionswörter verbunden, was genauer darauf schließen lässt, dass negative Reize eine Viktimisierungsmentalität aktivierten. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit früheren Untersuchungen, die zeigten, dass Grübeln negative Erinnerungen und Wahrnehmungen von Ereignissen in unterschiedlichen psychologischen Kontexten verstärkt. (citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.336.1616&rep=rep1&type=pdf) Auf Gruppenebene ist es wahrscheinlich, dass Gruppen Ereignisse anerkennen und sich daran erinnern, die den größten Einfluss auf sie hatten, einschließlich Ereignissen, bei denen die Gruppe durch eine andere Gruppe geschädigt wurde. verzeihen Die Forscher stellten außerdem fest, dass Menschen, die in ihren Beziehungen leicht Opfer von Übergriffen wurden, weniger bereit waren, ihren Peinigern nach Verletzungen zu vergeben, ein stärkeres Verlangen nach Rache zeigten, wenn sie diese vermeiden wollten, und tatsächlich eher zu Vergeltungsmaßnahmen neigten. Die Forscher vermuten, dass eine mögliche Erklärung für die geringen Vermeidungstendenzen darin liegt, dass Menschen mit höheren Werten bei zwischenmenschlichen Opfertendenzen ein höheres Bedürfnis nach Anerkennung haben. Wichtig ist, dass dieser Effekt durch die kognitive Perspektive vermittelt wurde, die negativ mit zwischenmenschlicher Viktimisierung verbunden war. Ähnliche Ergebnisse wurden auf Gruppenebene gefunden. Ein stärkeres Gefühl kollektiver Viktimisierung war mit einer geringeren Bereitschaft zur Vergebung und einem stärkeren Verlangen nach Rache verbunden. Diese Schlussfolgerung wurde in verschiedenen Zusammenhängen bestätigt, unter anderem im Hinblick auf den Holocaust, den Konflikt in Nordirland und den israelisch-palästinensischen Konflikt. Der Ursprung der Mentalität Woher kommt die Opfermentalität? Auf individueller Ebene spielen sicherlich viele verschiedene Faktoren eine Rolle, darunter auch die früheren Erfahrungen einer Person mit tatsächlicher Viktimisierung. Die Forscher stellten jedoch fest, dass eine ängstliche Bindungspersönlichkeit ein besonders starker Vorläufer zwischenmenschlicher Opfertendenzen ist. Ängstlich gebundene Menschen neigen dazu, sich auf die Zustimmung und ständige Bestätigung anderer zu verlassen. Aus Zweifeln an ihrem eigenen sozialen Wert streben sie ständig nach Bequemlichkeit. Dies führt dazu, dass die ängstlich abhängige Person andere Menschen mit einer sehr ambivalenten Einstellung betrachtet. Einerseits befürchten ängstlich gebundene Menschen, von anderen zurückgewiesen zu werden. Andererseits müssen sie sich auf andere verlassen, um ihr Selbstwertgefühl und ihren Wert zu bestätigen. Was den direkten Zusammenhang zwischen ängstlicher Bindung und zwischenmenschlicher Viktimisierung betrifft, weisen die Forscher darauf hin, dass „aus motivationaler Sicht die zwischenmenschliche Viktimisierung ängstlich gebundenen Personen einen wirksamen Rahmen für den Aufbau instabiler Beziehungen zu anderen zu bieten scheint, einschließlich des Strebens nach Aufmerksamkeit, Sympathie und Wertschätzung durch andere, während sie in zwischenmenschlichen Beziehungen schwierige negative Emotionen erleben und ausdrücken.“ Auf Gruppenebene weisen Gabay und ihre Kollegen auf die potenzielle Rolle von Sozialisationsprozessen bei der Entwicklung einer kollektiven Opfermentalität hin. Sie weisen darauf hin, dass Opfermentalität ebenso wie menschliche Überzeugungen erlernt werden kann. Über viele verschiedene Kanäle, wie etwa Aufklärung, Fernsehprogramme und soziale Medien, können Gruppenmitglieder lernen, dass Opferrolle als Machtspiel eingesetzt werden kann und dass Aggression legal und fair sein kann, auch wenn eine Partei geschädigt wird. Die Betroffenen lernen möglicherweise, dass ihnen die Verinnerlichung einer Opfermentalität Macht über andere verleihen und sie vor den Konsequenzen von Online-Belästigung und Beschämung schützen kann, die vermeintlich Außenseiter erleiden könnten. (journals.sagepub.com/doi/10.1177/1088868315607800) Vom Opfer zum Wachstum Tatsache ist, dass wir derzeit in einer Kultur leben, in der viele politische und kulturelle Gruppen und Einzelpersonen ihre Opferrolle betonen und gemeinsam an den „Opferolympiaden“ teilnehmen. Charles Sykes, Autor von „A Nation of Victims: The Decay of the American Character“, argumentiert, dass dieses Phänomen teilweise auf das Recht von Gruppen und Einzelpersonen zurückzuführen sei, nach Glück und Erfüllung zu streben. Aufbauend auf Sykes‘ Arbeit stellen Gabay und ihre Kollegen fest, dass „wenn diese Anspruchshaltungen mit einer ausgeprägten Tendenz zur Opferrolle auf individueller Ebene einhergehen, der Kampf um sozialen Wandel eher aggressive, erniedrigende und herablassende Formen annimmt.“ Aber hier ist der Punkt: Wenn der Sozialisierungsprozess in Menschen eine Opfermentalität einflößen kann, dann kann derselbe Prozess sicherlich auch eine Denkweise zur persönlichen Weiterentwicklung in Menschen einflößen. Was wäre, wenn wir schon in jungen Jahren wüssten, dass unser Trauma uns nicht definieren muss? Ist die Opferrolle, die wir erlebt haben, nicht ein wesentlicher Teil unserer Persönlichkeit? Ist es uns überhaupt möglich, an einem Trauma zu wachsen und bessere Menschen zu werden, indem wir die Erfahrungen unseres Lebens nutzen, um anderen in ähnlichen Situationen Hoffnung und Zukunftschancen zu vermitteln? Was wäre, wenn wir alle erkennen würden, dass wir stolz auf eine Gruppe sein können, ohne andere zu hassen? Was wäre, wenn wir erkennen würden, dass wir von anderen Freundlichkeit erwarten und selbst freundlicher sein müssen? Was wäre, wenn wir erkennen würden, dass niemand Anspruch auf irgendetwas hat, wir es aber verdienen, als Menschen behandelt zu werden? Dies wäre ein ziemlich großer Paradigmenwechsel, stünde aber im Einklang mit den neuesten Erkenntnissen der Sozialwissenschaften, die besagen, dass eine fortwährende Opfermentalität dazu führt, dass wir die Welt durch einen Filter sehen. Sobald wir den Filter entfernen, können wir sehen, dass die Aussage „Wer nicht meiner Art ist, muss ein anderes Herz haben“ nicht stimmt und dass niemand in unserer Gruppe ein Heiliger ist. Wir sind alle Menschen mit den gleichen grundlegenden Bedürfnissen: dazuzugehören, gesehen und gehört zu werden, einen Sinn im Leben zu haben. Die Realität so klar wie möglich zu sehen, ist ein wichtiger Schritt hin zu einer dauerhaften Veränderung. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist die Abkehr von der ewigen Opfermentalität hin zu etwas Produktiverem, Konstruktiverem, Hoffnungsvollerem und der Bereitschaft, positive Beziehungen zu anderen aufzubauen. Von Scott Barry Kaufman Übersetzt von Sue Korrekturlesen/boomchacha Originalartikel/www.scientificamerican.com/article/unraveling-the-mindset-of-victimhood/ Dieser Artikel basiert auf einer Creative Commons-Lizenz (BY-NC) und wird von Sue auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
Artikel empfehlen
Welche Köstlichkeiten lassen sich aus getrockneter Mango zubereiten? Kann getrocknete Mango gekühlt werden?
Der Geschmack getrockneter Mango ist süß-sauer, a...
Wann ist der beste Zeitpunkt, um Stecklinge vom Tigerdorn zu schneiden? Wie kann Tigerdorn durch Stecklinge überleben?
Euphorbia milii ist eine in unserem täglichen Leb...
Zeitpunkt und Methode zum Schneiden von Maulbeeren
Maulbeerschnittzeit Maulbeerbäume eignen sich für...
Wie man Lotusblattbrei macht
Ich glaube, dass jeder nur wenig über Lotusblatt-...
Vergleich der Nährwerte von Pflaume, Aprikose, Pfirsich und Nektarine
Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche und Nektarinen sin...
Möchten Sie Süßigkeiten essen, ohne die „Belastung“? Wir zeigen Ihnen 5 Tipps zur Zuckerkontrolle
Ob Kinder oder Erwachsene, der Versuchung von Süß...
So bereiten Sie köstliches süß-saures Schweinefleisch zu
Jeder kennt wahrscheinlich süß-saures Schweinefle...
Köstlichkeiten und Gefahren existieren nebeneinander. Hüten Sie sich vor dem „Killer Nummer eins“ bei Meeresfrüchten – Vibrio parahaemolyticus!
Sommernacht Natürlich dürfen Mitternachtssnacks n...
Wie wäre es mit Harrods? Harrods-Bewertungen und Website-Informationen
Was ist die Harrods-Website? Harrods ist das bekan...
Wie wäre es mit Topshop? Topshop-Bewertungen und Website-Informationen
Was ist Topshop? TOPSHOP ist eine bekannte Fast-Fa...
Warum ist Mungbohnensuppe rot?
Mungobohnen haben ein smaragdgrünes Aussehen, dah...
Essen Sie nicht zu viel, wenn Sie hungrig sind, und trinken Sie nicht zu viel, wenn Sie durstig sind! Tägliche Gesundheitspflege, merken Sie sich diese acht Worte
In den „Annotationen zu alten und modernen Kranke...
Welcher Dünger ist am besten für Ixora
Düngezeit für Ixora Die Drachenbootblume muss wäh...