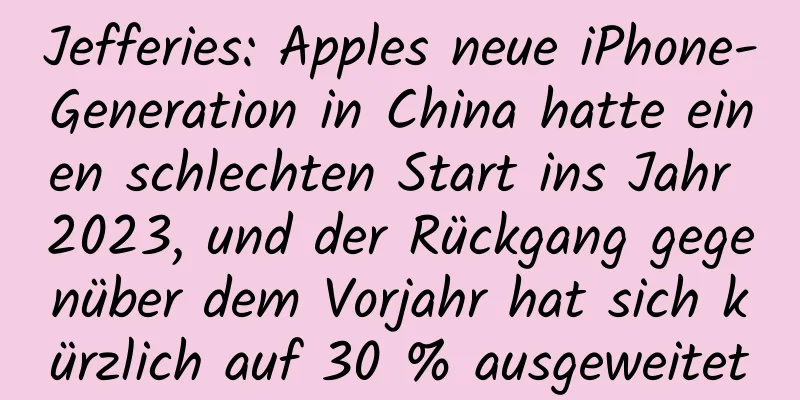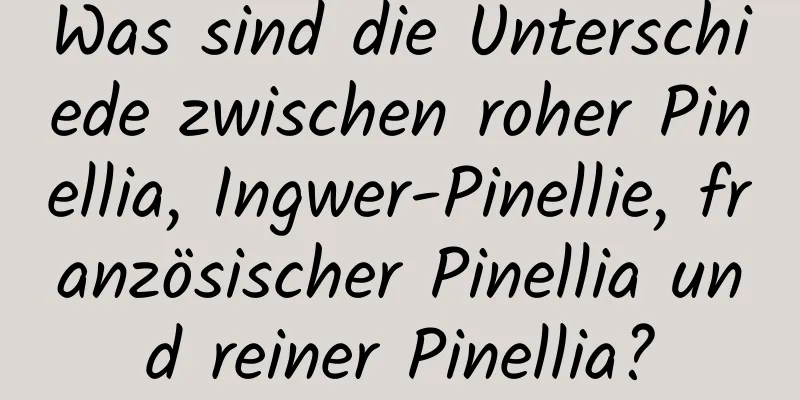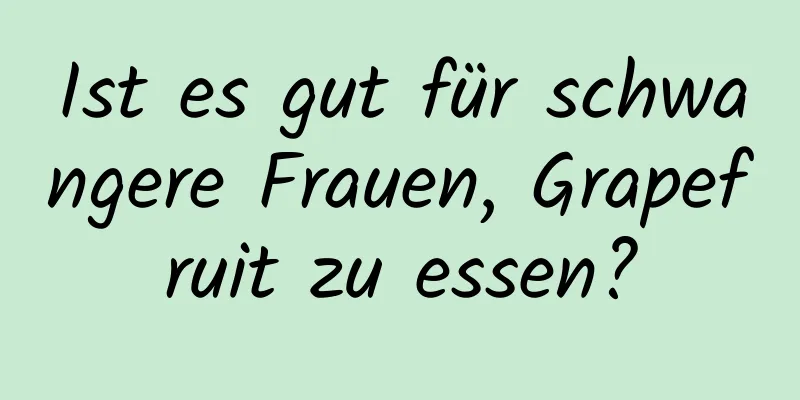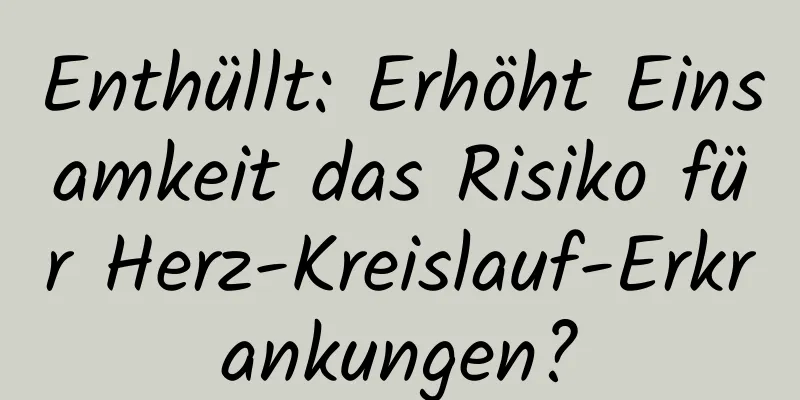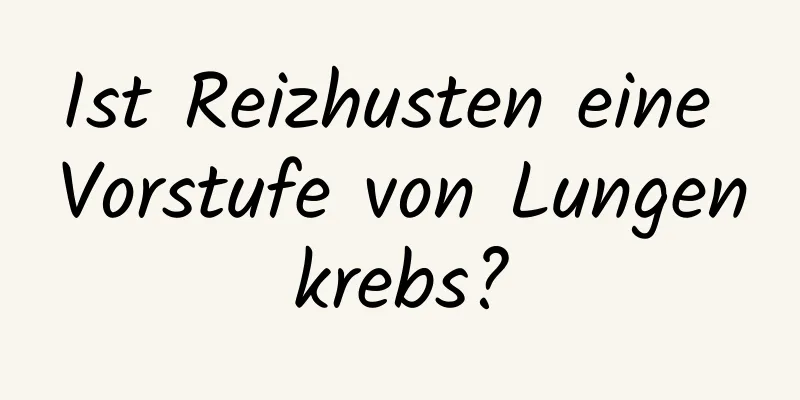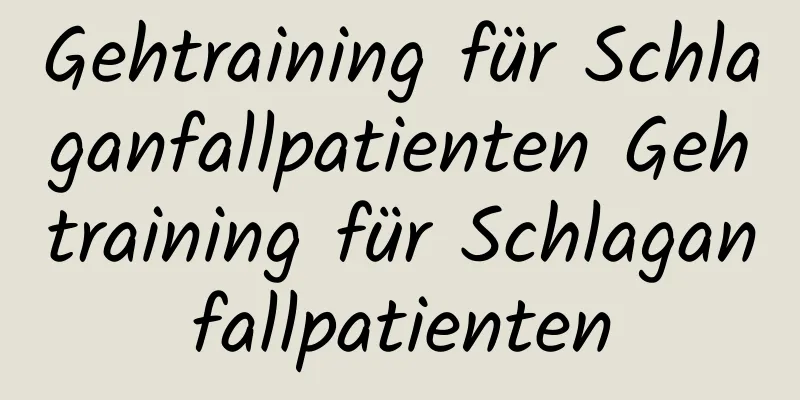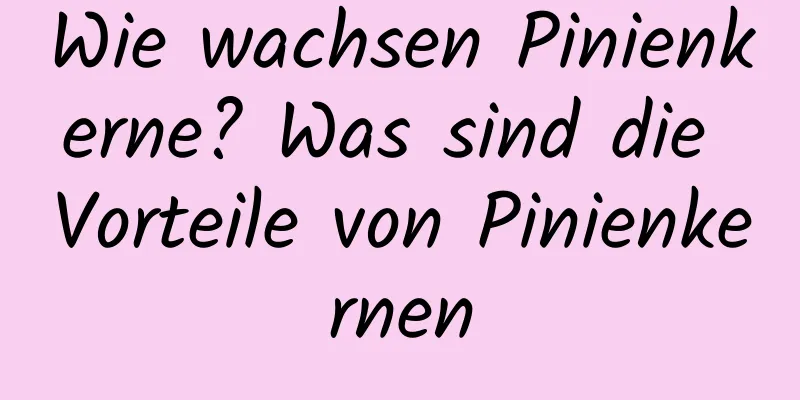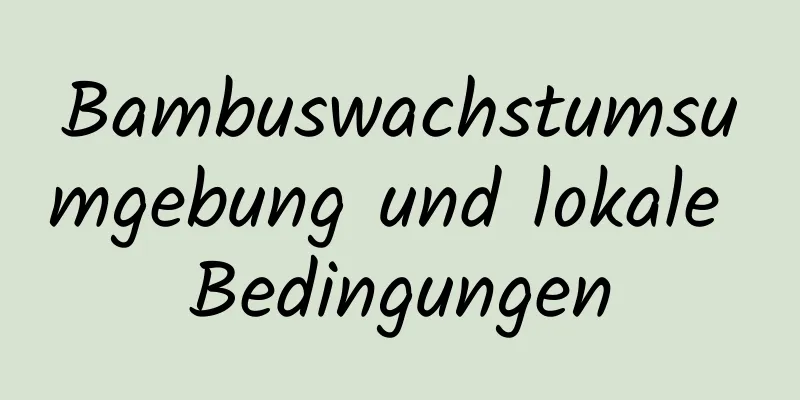Macht die moderne Gesellschaft ältere Menschen anfälliger für Demenz?

|
Warum wird eine genetische Mutation, die als schlecht angesehen wird, nicht durch natürliche Selektion eliminiert, sondern bleibt in der menschlichen Population bestehen? Vielleicht liegt es daran, dass es in den Jahrtausenden vor der Industrialisierung eine positive Wirkung auf die Menschheit hatte. Wir leben in einer völlig anderen Umgebung. Dieser Artikel darf ausschließlich aus Kapitel 19 von „Borrowed Time“ (Shanghai Education Press) entnommen werden. Von Sue Armstrong Übersetzung | Chen Youxun „Meines Erachtens ist vielleicht die Hälfte aller Alzheimer-Fälle umweltbedingt“, sagt Caleb „Tucker“ Finch, Professor für Neurowissenschaften an der University of Southern California und Doyen auf dem Gebiet der Neurobiologie des Alterns. Ja, er ist in dieser Hinsicht tatsächlich ein echter Pionier. Finch verbrachte den Großteil seiner Karriere am College. Als wir einmal auf dem Universitätscampus zusammen zu Mittag aßen, erzählte er mir, dass sein Fachgebiet im Jahr 1965, als er seine Arbeit aufnahm, noch relativ unbekannt gewesen sei. Als er 1959 seinen Bachelor-Abschluss in Yale machte, erwog Finch, in das aufstrebende Gebiet der Entwicklungsbiologie einzusteigen, das eine aufregende Zukunft versprach. Einer seiner Mentoren in Yale, der Mikrobiologe Carl Woese, war eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die eine Gruppe von Mikroorganismen namens Archaeen entdeckte, die unser Verständnis des Baums des Lebens revolutionieren sollte. Die andere Seite des Lebensbaums, so der Mentor, könnte für uns sogar noch größere Herausforderungen mit sich bringen. „Sein Rat an mich lautete: Wenn Sie wirklich in einem neuen Bereich neu anfangen möchten, warum ziehen Sie dann nicht in Erwägung, das Altern zu studieren?“ Finch erinnerte sich. „Als Doktorand schrieb ich schließlich meine Dissertation über das Altern und ich hatte das Gefühl, dass das Gehirn dabei eine wichtige Rolle spielt … Nachdem ich 1965 die Gliederung meiner Dissertation geschrieben hatte, hatte ich meine Berufswahl getroffen – ich beschloss, dies zu meiner lebenslangen Karriere zu machen.“ Seitdem konnte Finchs Entschlossenheit nichts erschüttern, nicht einmal die abweisenden Bemerkungen des berühmten Virologen Peyton Rous. Von Letzterem haben Sie vielleicht eine Vorstellung, denn wir haben ihn im vorigen Kapitel vorgestellt und wussten, dass er Leonard Hayflicks bahnbrechende Entdeckung, dass die Lebensdauer von Zellen während der Teilung begrenzt ist, infrage stellte. Als Finch während seines Doktoratsstudiums öffentlich über seine Forschungen zum alternden Gehirn sprach, meinte Routh, er würde seine Zeit verschwenden, da jeder wisse, dass das Altern nur zu Gefäßerkrankungen und Krebs führe, erinnert er sich. Finch, jetzt in seinen 80ern, ist groß, dünn, leicht bucklig, kahl und hat einen dichten grauen Bart, aber er hat einen schnellen Verstand und ist voller Neugier auf die Dinge um ihn herum. Ein ehemaliger Doktorand beschrieb ihn in einem Profil für das Magazin Science: „Er sah aus wie ein Wesen aus einer anderen Welt, als wäre er erst letzte Woche aus den Appalachen heruntergekommen.“ Der letzte Kommentar ist relevant, da Finch in seiner Freizeit Geige spielt und Mitglied der Iron Mountain String Band war, die er 1963 mit seinem Freund Eric Davidson, einem anderen Entwicklungsbiologen, gründete und in der er selbst Mitglied war. In der Grundschule lernte er Trompete und mit 22 Jahren brachte er sich selbst das Spielen der traditionellen Appalachen-Geige bei. Bevor sich die beiden Wissenschaftler trafen, sammelte Davidson an der Graduiertenschule in New York traditionelle Musik aus dem Südwesten von North Carolina und Virginia für die Smithsonian Library of Congress. Anschließend schloss sich Fincher ihm an und verbrachte jedes Jahr etwa eine Woche dort, um Musik zu sammeln und sie mit ihrer schweren alten Aufnahmeausrüstung zu transkribieren. „Man könnte eine Kleinstadt besuchen, in den örtlichen Friseursalon oder in den Baumarkt gehen und fragen: ‚Wer hier spielt die altmodische Geige oder das Banjo?‘ Und man würde sich zu den Leuten nach Hause durcharbeiten, ihnen beim Spielen zuhören und Aufnahmen machen“, erinnert sich Finch. „Unsere Band basierte auf dieser Musik, es war also eine Zeit vor dem Bluegrass, eine traditionelle Streichorchester aus den Appalachen.“ Finch lacht, als er sich an die Tage unter einem Feigenbaum von Morton Bay im Campus-Café erinnert, und bemerkt, dass nur wenige der Leute, denen sie auf der Straße begegneten, eine Ahnung hatten, was sie da jeden Tag taten. Während er redete, hatte er unwissentlich einen Teller Hamburger und Pommes frites leer gegessen. Was Finch als Wissenschaftler auszeichnet, ist die große Bandbreite der Themen, die er untersucht. „Ich habe einen neuen Bereich abgegrenzt, den nur wenige meiner Kollegen oder Kollegen in der biomedizinischen Gerontologie bemerkt hatten, nämlich Umweltfaktoren, die zur Alterung beitragen und die meiner Meinung nach für den Menschen weitaus wichtiger sind als die genetische Variation“, erklärt er. Er glaubt, dass der Einfluss der Umwelt auf das Altern weitgehend ignoriert wurde, „weil er sehr schwer zu untersuchen ist. Man braucht völlig andere theoretische Annahmen und Denkweisen, die sich nicht aus dem traditionellen Reduktionismus der Biochemie und Molekularbiologie ableiten lassen. Meiner Meinung nach ist der traditionelle Reduktionismus eine gute Strategie für diese Probleme, aber das Phänomen des Alterns ist ein hochmodernes Forschungsgebiet.“ Auch die Berufsausbildung, die Finch erhielt, unterschied sich stark von der der normalen Leute. Während seines Studiums in Yale konnte er als Laborassistent in der neu gegründeten Abteilung für Biophysik arbeiten. „Es gab eine Gruppe brillanter Physiker, die sich mit Biologie beschäftigten und Fragen stellten, die sonst niemand stellte“, erinnert er sich. „Da habe ich angefangen. Ich hatte das Glück, schon früh in meiner Karriere großartige Mentoren zu haben, die mir beigebracht haben, keine Angst davor zu haben, Fragen zu stellen, die andere verärgern“, sagt er. Ihre Einstellung war: „Wenn es noch nicht gemacht wurde, keine Sorge, das heißt nicht, dass es sich nicht lohnt, es zu tun … Lassen Sie diese Papiere in Ruhe … Lassen Sie uns einen umfassenderen Blick auf das werfen, was im Leben vor sich geht und was dazu führt, dass es sich anders verhält als in der Physik.“ Das war meine Ausbildung.“ Was Finch heute interessiert, ist die Frage, wie sich die Alterskrankheiten in den letzten 200 Jahren angesichts der gestiegenen Lebenserwartung der Menschen verändert haben. Insbesondere fragt er sich, ob unsere moderne Umwelt altersbedingte Krankheiten verschlimmert, die in vorindustriellen Zeiten möglicherweise selten waren. In einer interdisziplinären Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Anthropologen und Biomedizinern hat er das Volk der Tsimane im bolivianischen Amazonasgebiet untersucht. Bis vor Kurzem jagten, sammelten, fischten und betrieben diese Tsimane wie in der Vergangenheit Landwirtschaft, ohne jedoch auf die Vorteile moderner Medizin oder anderer Annehmlichkeiten zurückgreifen zu können. „Sie litten ständig unter Entzündungen. Sie hatten Parasiten. Sie hatten Tuberkulose und waren aufgrund der harten Arbeit, die sie jeden Tag verrichteten, ständig krank“, sagte Finch. „Man könnte meinen, dass sie anfällig für Herzkrankheiten wären, weil Entzündungen so viele Krankheiten verursachen, aber das ist nicht der Fall.“ Im Laufe der Jahre haben Kardiologen des Forschungsteams im Rahmen des langjährigen Tsimane Health and Life History Project CT-Scans und Elektrokardiogramme an Hunderten von Tsimane-Teilnehmern durchgeführt. Sie fanden heraus, dass sich die Arterienverkalkung bei den Tsimane viel später im Leben entwickelt als bei anderen Menschen in der modernen Gesellschaft, sodass das Gefäßalter eines 80-jährigen Tsimane typischerweise etwa dem eines Amerikaners in seinen 50ern entspricht. „Wir haben bei ihnen auch Gehirnscans durchgeführt und festgestellt, dass der Verlust grauer Substanz im Alter bei ihnen mindestens 50 Prozent langsamer ist als bei Menschen in Nordamerika und Europa“, sagte Finch. Im Laufe der Jahre wurden auch zahlreiche Daten zur kognitiven Funktion der Amazonasbewohner gesammelt, die nun einige interessante Erkenntnisse über die Wechselwirkung zwischen Genen und Umwelt liefern. APOE e4 gilt in den Industrieländern als der größte Risikofaktor für die Alzheimer-Krankheit, doch bei den Tsmanianern, die häufig mit Parasiten infiziert sind, scheint das Gen ihren Gehirnen Schutz zu bieten. Darüber hinaus scheint das Gen bereits in sehr jungem Alter zu wirken: Tsman-Kinder, die eine Kopie des APOE e4-Gens in sich tragen, sind tendenziell intelligenter als Kinder ohne diese Kopie. Dies spiegelt die Ergebnisse von Studien mit Kindern in armen Vierteln von Mexiko-Stadt und Brasilien wider: Diese Kinder waren besonders anfällig für Infektionen, doch diejenigen mit der Variante e4 schienen über bessere kognitive Fähigkeiten zu verfügen. Die Beziehung zwischen Bakterien und Genen und die Auswirkungen dieser Beziehung auf das Gehirn sind jedoch komplex. Unkontrollierte parasitäre Infektionen können das Gehirn selbst schädigen, sodass Menschen jeden Alters gefährdet wären, wenn sie nicht die schützende Variante APOE e4 in sich tragen würden. Bei den wenigen Individuen, die aus irgendeinem Grund nicht mit dem Parasiten infiziert waren, aber das APOE e4-Gen trugen, verhielt sich die Variante wie in der modernen Gesellschaft – sie erhöhte das Risiko eines geistigen Abbaus. Laut Finch böten die Ergebnisse eine plausible Erklärung dafür, warum eine als schädlich geltende Genvariante in menschlichen Populationen bestehen blieb, anstatt durch natürliche Selektion eliminiert zu werden: Sie hatte eine positive Wirkung auf die Menschen, die in den Jahrtausenden vor der Industrialisierung lebten, weil sie in engem Kontakt mit einer großen Zahl invasiver Organismen standen. Daraus lassen sich auch Hinweise gewinnen, die erklären, warum die oben erwähnten Auswirkungen von APOE e4 bei verschiedenen Rassen unterschiedlich sind. Ram Rao, ein Neurologe, der am Buck Institute APOE erforscht, blickt auf die Ursprünge der Neandertaler zurück. Er stimmt mit Finchs Erklärung überein, warum die schädliche Variante e4 beim Menschen fortbesteht. „Es ist eine großartige Geschichte“, sagt er begeistert. APOE verursacht Entzündungen. Tatsache ist, dass Höhlenmenschen immer auf Nahrungssuche waren. Sie hatten keine Schuhe, keine Socken, keine Pantoffeln. Sie gingen auf nacktem Boden und kletterten manchmal auf Bäume. Sie mussten kilometerweit laufen, um eine gute Beute zu finden und nach Hause zu bringen. Dabei bekamen sie Infektionen und bluteten [aus Schnitten und Kratzern]. Und wenn sie dann keine Beute erlegten, mussten sie lange hungern. All das erforderte, dass sie aktiv blieben, und APOE half ihnen dabei. Also war APOE ein Segen für sie … es verhinderte die Ausbreitung von Infektionen im Körper.“ Nun erhält derselbe Höhlenmensch die medizinische Versorgung, die er braucht, wird älter als 50, trägt ständig Schuhe, Hosen und Hemden und isst allerlei ungesunde Lebensmittel, und das APOE e4 in seinem Körper weiß nicht, was es tun soll. Es gerät durcheinander. Das Gen für „gut und böse“ beginnt nun, seine böse Seite zu zeigen. Dasselbe APOE e4 wird zum Übeltäter für die Entzündung, die ursprünglich dazu diente, dass der Körper gesund blieb, die jetzt, mit zunehmendem Alter, zu Funktionsstörungen des Körpers führt. Doch welche Beziehung besteht zwischen Genen und Bakterien auf zellulärer Ebene tief im Gehirn der Amazonasbewohner? Auf Grundlage einer sorgfältigen Untersuchung umfangreicher Daten aus Exkursionen in den Dschungel gehen die Forscher davon aus, dass APOE e4 die Tsimane durch zwei mögliche Mechanismen schützt: durch Neutralisierung und Beseitigung von Parasiten aus ihrem Körper oder durch Milderung der Auswirkungen parasitärer Infektionen durch Veränderung des Cholesterinstoffwechsels im Gehirn. Aber die Entwicklung einer Theorie ist nur der Anfang. die große Herausforderung besteht darin, dies zu bestätigen oder zu widerlegen und die Funktionsweise im Detail zu erklären. Das Forschungsprojekt, das in vorindustriellen Bevölkerungen durchgeführt wurde, könnte verlockende Beweise für die Rolle liefern, die die Umwelt bei der Alterung unseres Gehirns spielt. Doch wo können noch Gefahren für die Umwelt bestehen, wenn die moderne Gesellschaft doch zahlreiche Maßnahmen zur Abwehr von Insekten und Bakterien ergriffen hat? Finch weist jedoch darauf hin, dass es in der modernen Gesellschaft viele potenzielle Bedrohungen gibt, und sein Hauptaugenmerk liegt derzeit auf der Luftverschmutzung. Dabei handelt es sich um ultrafeine Partikel mit einem Durchmesser von maximal 2,5 Mikrometern (etwa 30-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Sie werden als PM2,5 (Partikel 2,5) bezeichnet, entstehen bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe und werden hauptsächlich durch Kraftwerke und die Auspuffrohre von Kraftfahrzeugen in die Atmosphäre abgegeben. Sie enthält zahlreiche Schadstoffe wie Sulfate, Nitrate, Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle wie Blei, Nickel und Quecksilber. Nach einer Zeit intensiver Forschung gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass Luftverschmutzung das Gehirn schädigen kann. Anfang der 2000er Jahre beispielsweise identifizierte die Weltgesundheitsorganisation Mexiko-Stadt als einen der Orte mit der höchsten Smogbelastung der Welt. Daraufhin begannen Forscher in Mexiko-Stadt, die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf Hunde zu überwachen. Da Hunde unter denselben Umweltbedingungen leben wie Menschen, konnten sie den Schaden abschätzen, den die Luftverschmutzung den Stadtbewohnern zufügen kann. Laut der Leiterin des Forschungsteams, Dr. Lilian Calderón-Garcidueñas, berichteten Einwohner von Mexiko-Stadt von Anzeichen ungewöhnlichen Verhaltens bei ihren Hunden, wie etwa Veränderungen im Schlafverhalten und unaufhörliches Bellen. Einige Hundebesitzer berichteten den Forschern, dass ihre Hunde für ihre Besitzer manchmal scheinbar nicht wiederzuerkennen seien. Die Forscher beobachteten die Hunde genau und untersuchten die Gehirne der verstorbenen Hunde. Dabei stellten sie fest, dass deren Gehirne Ansammlungen von Beta-Amyloid-Protein, Plaques und andere Pathologien aufwiesen, die der Alzheimer-Krankheit beim Menschen ähnelten, darunter auch abgestorbene Neuronen. Im Jahr 2003 veröffentlichten Forscher einen Bericht in der Zeitschrift Toxicological Pathology. Im letzten Absatz schreiben sie: „Diese Befunde bei Hunden sind von ausreichender Tragweite und klinischer Bedeutung, um die Befürchtung zu wecken, dass ähnliche Erkrankungen bei Menschen, die in Großstädten leben oder hohen Feinstaubbelastungen durch Waldbrände, Naturkatastrophen oder Kriegsereignisse ausgesetzt sind, beschleunigt auftreten könnten. Neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer könnten mit Luftverschmutzung zusammenhängen.“ Einige neuere Studien in den USA und anderswo deuten auf einen Zusammenhang zwischen dem geistigen Abbau bei älteren Menschen und der Belastung durch Feinstaub hin. Finch und seine Kollegen arbeiten an einem Projekt, das epidemiologische Studien am Menschen mit Experimenten an Mäusen und Zellkulturen kombiniert, um eine große Menge indirekter Beweise für einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zu sammeln. Sie wollten drei allgemeine Fragen beantworten: Besteht bei älteren Menschen ein erhöhtes Demenzrisiko, wenn sie in Gebieten mit hohen PM2,5-Konzentrationen in der Luft leben? Sind Träger des APOE e4-Gens empfindlicher gegenüber den Auswirkungen dieser Schadstoffe? Können diese Erkenntnisse aus der Arbeit mit Menschen unter kontrollierten Laborbedingungen auf Mäuse übertragen werden, die das APOE-Gen tragen? Sie sind überzeugt, dass die Beantwortung aller drei Fragen „Ja“ sein wird, „dadurch werden die zugrundeliegenden Wirkmechanismen im menschlichen Gehirn aufgedeckt.“ Für den menschlichen Teil des Projekts arbeiteten Finch und sein USC-Kollege, der Epidemiologe Jiu-Chiuan Chen, mit Forschern der Wake Forest University School of Medicine in North Carolina zusammen, als diese die Women's Health Initiative Memory Study (WHIMS) durchführten. Die Forscher wählten aus der Datenbank eine Stichprobe von 3.647 Frauen aus, die seit Ende der 1990er Jahre in die Studie einbezogen worden waren. Sie waren zum Zeitpunkt der Rekrutierung zwischen 65 und 79 Jahre alt und zeigten keinerlei Anzeichen einer geistigen Behinderung. Diese Frauen kamen aus allen Teilen der Vereinigten Staaten. WHIMS verfügt über detaillierte Informationen zu allen Teilnehmern, darunter ihre körperlichen Merkmale, ihre Krankengeschichte, ihren Lebensstil, ihr Verhalten und ihre genetischen Merkmale. Letztere sind besonders wichtig, da sie Aufschluss über ihren APOE-Status geben können. Mithilfe dieser umfangreichen Ressource und der von der US-Umweltschutzbehörde gesammelten Daten zur Luftqualität erstellte das USC-Team ein mathematisches Modell, mit dem es die täglichen PM2,5-Werte im Freien an verschiedenen Standorten in den zehn Jahren vor 2010 ermitteln konnte, um abzuschätzen, ob die Frauen in der Studie diesen schädlichen Schadstoffen wahrscheinlich ausgesetzt waren. Als alle Rätsel gelöst waren, stellten die Forscher fest, dass Frauen, die in Gegenden lebten, in denen die Luftverschmutzung regelmäßig die nationalen Sicherheitsstandards überschritt, einen viel schnelleren geistigen Abbau erlitten und fast doppelt so häufig an Demenz, einschließlich Alzheimer, erkrankten wie Frauen, die in weniger verschmutzten Umgebungen lebten. Darüber hinaus besteht bei Frauen, die das APOE e4-Gen tragen, ein zwei- bis dreifach höheres Risiko für die Erkrankung als bei Frauen, die andere Varianten des Gens tragen. „Wenn unsere Ergebnisse auch auf die Gesamtbevölkerung zutreffen, dann könnte die Feinstaubbelastung in der Luft zu jedem fünften Demenzfall beitragen“, kommentierte Finch. Zurück im Labor setzten Finch und sein Team Mäuse, die so gezüchtet wurden, dass sie die menschliche APOE-Genvariante trugen, sorgfältig kontrollierten Dosen des ultrafeinen Schadstoffs PM2,5 aus, der durch den Autoverkehr auf den Straßen, die den USC-Campus durchqueren, gesammelt wurde. Sie führten dieses Projekt in Zusammenarbeit mit Constantinos Sioutas von der USC School of Engineering durch. Sutus hat ein komplexes System aus Rohren und Filtern entwickelt, das Autoabgase auffängt und in einer suspendierten Flüssigkeit speichert. Anschließend könnten sie die Suspension erneut vernebeln, um Mäuse im Labor der Kontamination auszusetzen. „Das ist doch ein viel besserer Ansatz, als Ratten in Käfige zu sperren und sie in die Nähe der Autobahn zu bringen, oder?“ sagte Finch. Die Hälfte der Mäuse wurde 15 Wochen lang durchschnittlich fünf Stunden am Tag, drei Tage die Woche, Abgasen ausgesetzt. Die andere Hälfte bzw. die Kontrollgruppe der Mäuse durfte saubere Luft atmen. Anschließend töteten sie alle Mäuse und untersuchten und verglichen ihre Gehirne. Die Forscher stellten fest, dass zahlreiche Entzündungen durch Mikroglia verursacht wurden. Dabei handelt es sich um Reinigungszellen des Immunsystems des Gehirns, die aktiviert werden, um eindringende Partikel zu bekämpfen. Sie fanden außerdem heraus, dass Mikroglia hohe Konzentrationen eines Entzündungsmoleküls namens TNF-α (Tumornekrosefaktor) freisetzen, das im Gehirn von Alzheimer-Patienten häufig erhöht ist und zu Gedächtnisverlust führen kann. Ähnlich wie bei der Studie von Lillian Calderón-Garcidueñas an Hunden in Mexiko-Stadt stellte Finchs Team eine übermäßige Ansammlung von Amyloid-β in den Gehirnen von Mäusen fest, die Umweltverschmutzung ausgesetzt waren. Um eine genauere Analyse auf molekularer Ebene durchzuführen, züchteten sie Zellen des Immunsystems des Gehirns in Laborschalen und setzten sie Abgasen aus. „Wir wissen jetzt, dass Partikel aus fossilen Brennstoffen direkt über die Nase ins Gehirn gelangen und auch über die Lunge in den Kreislauf des Körpers gelangen können, was letztendlich eine Entzündungsreaktion verursacht, die unser Alzheimerrisiko erhöht und den Krankheitsverlauf selbst beschleunigt“, sagte Finch in einer Pressemitteilung der USC. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass wir durch Laborstudien an genetisch veränderten Mäusen „eindeutig nachweisen konnten, dass die Belastung durch Luftverschmutzung den Amyloidspiegel im Gehirn erhöht, und dieser Anstieg war bei Mäusen, die den menschlichen Alzheimer-Risikofaktor APOE e4 trugen, sogar noch ausgeprägter.“ Unser Gehirn wird durch die sogenannte Blut-Hirn-Schranke geschützt, die verhindert, dass Mikroben und andere schädliche Substanzen in den Blutkreislauf gelangen. Die Blut-Hirn-Schranke ist eine semipermeable Schicht aus Endothelzellen, die die Wände der Blutgefäße im Gehirn eng umschließt. Wir wissen jedoch, sagte Finch, dass bei Patienten mit der Genvariante APOE e4 die Blut-Hirn-Schranke durchlässiger als normal ist, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass eingeatmete ultrafeine Partikel ins Gehirn gelangen können. Ultrafeine Partikel, die direkt durch die Nase ins Gehirn gelangen, wandern entlang des Riechnervs, der uns unseren Geruchssinn verleiht und mit dem Hippocampus verbunden ist, wo Erinnerungen gespeichert sind. Seitdem Organismen die für das Überleben der Art entscheidende Fähigkeit erlangt haben, unmittelbar zu riechen und so Informationen aus ihrer Umgebung zu erhalten, sind die Riechnerven, die ihre Arbeit in der Nasenhöhle aufnehmen, die einzige natürliche Lücke in der Blut-Hirn-Schranke. Hunde haben einen weitaus feineren Geruchssinn als wir, doch Calderón-Garcidueñas stellte bei seiner Tierstudie in Mexiko-Stadt fest, dass ihr Geruchssystem von der Nase bis zum Gehirn stark geschädigt ist. Interessanterweise wurde vor kurzem festgestellt, dass die Unfähigkeit, bestimmte Gerüche wahrzunehmen, ein frühes Anzeichen der Alzheimer-Krankheit ist. Der Hauptmechanismus scheint auf die Ansammlung von Beta-Amyloid zurückzuführen zu sein, das die Riechnervenzellen tötet. An der USC interessierte sich Finch auch für die Auswirkungen des Rauchens auf die Luftverschmutzung, wozu einige Hintergrundinformationen erforderlich sind. Es ist seit langem bekannt, dass Rauchen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs erhöht. Bis 2010 war der Zusammenhang zwischen Rauchen und Demenz jedoch umstritten: Einige Studien zeigten, dass Rauchen das Krankheitsrisiko tatsächlich erhöhte, während andere keinen Effekt feststellten und wieder andere sogar behaupteten, das Krankheitsrisiko sei sogar verringert. Im Jahr 2010 veröffentlichten Janine Cataldo von der University of California in San Francisco und ihre Kollegen eine Abhandlung, in der sie beschrieben, wie sie zur Beantwortung dieser Frage die Designprinzipien, Forschungsmethoden und Ergebnisse von 43 ursprünglichen internationalen Studien, die zwischen 1984 und 2009 durchgeführt wurden, systematisch analysiert hatten. Um mögliche Interessenkonflikte in ihren Ergebnissen auszuschließen, untersuchten sie insbesondere auch die Finanzierung der beteiligten Wissenschaftler und die Zugehörigkeit zu den Abteilungen, für die sie arbeiteten. Dies schien von den Zeitschriften, die die Berichte veröffentlichten, überraschenderweise übersehen worden zu sein. Wer mit den Bemühungen der Tabakindustrie vertraut ist, Beweise dafür, dass Rauchen Krebs verursacht, zu diskreditieren, wird von den Ergebnissen von Cataldo und ihren Kollegen nicht überrascht sein: Der Einfluss der Tabakunternehmen ist in allen Beweisen zur Alzheimer-Krankheit erkennbar. Daher wird es zu einer wichtigen Detektivaufgabe, herauszufinden, welche Forschungsprojekte und welche Wissenschaftler die Tabakkonzerne unterstützen. Dabei handelte es sich um eine umfassende Durchsuchung einer großen Menge interner Dokumente in traditionellen Tabakarchiven, die geheim gehalten worden waren, aber durch Klagen von Kunden, die sich über durch das Rauchen verursachte Personenschäden und Todesfälle ärgerten, an die Öffentlichkeit gelangten. Die Forscher stellten fest, dass elf der 43 in ihre Metaanalyse[1] einbezogenen Studien von Wissenschaftlern durchgeführt wurden, die Verbindungen zur Tabakindustrie hatten, und nur drei von ihnen legten diese Verbindungen offen. Keine der elf Studien konnte ein erhöhtes Alzheimerrisiko bei Rauchern feststellen. Tatsächlich zeigten acht der Studien sogar ein verringertes Risiko, während die anderen keinen signifikanten Effekt feststellten. Nach Berücksichtigung von Verzerrungen in von der Tabakindustrie unterstützten Studien und anderer Faktoren wie dem Studiendesign kamen Cataldo und ihr Team jedoch zu dem Schluss, dass „Rauchen nicht vor der Alzheimer-Krankheit schützt“. Tatsächlich zeigten die ihnen vorliegenden Daten, dass „Rauchen ein wesentlicher und wichtiger Risikofaktor für die Alzheimer-Krankheit ist“. Was also bedeuten diese Daten für einen Raucher? Dies hängt offensichtlich davon ab, wie viele Zigaretten eine Person täglich raucht, wie lange sie schon raucht, von ihrem genetischen Hintergrund und von vielen anderen Variablen. Allerdings zitierte ein Informationsblatt der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2014 Studien aus aller Welt, denen zufolge Rauchen das Krankheitsrisiko um 59 bis 79 Prozent erhöht. Darüber hinaus schätzt die WHO, dass etwa 14 % der Alzheimer-Fälle weltweit „wahrscheinlich auf das Rauchen zurückzuführen“ sind. Laut Finch kann Tabak durch viele verschiedene Mechanismen das Risiko einer Person für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs erhöhen oder beschleunigen. Aber wie sieht es mit den Auswirkungen auf das Gehirn aus? Er erforscht die Wechselwirkungen zwischen Rauchen und Luftverschmutzung und untersucht, inwieweit ihre Wirkungsmechanismen dieselben sind und ob die beiden Luftverschmutzungszustände zusammenwirken und so einen additiven Effekt auf das Alzheimerrisiko der Menschen erzeugen. Aus den uns bisher vorliegenden Beweisen, sagte er, „schließe ich, dass diese Kombination noch einen weiteren Schaden verursacht, der nicht allgemein anerkannt ist und für den uns kein direkt verfügbarer Mechanismus zur Erklärung zur Verfügung steht.“ Aus einer anderen Perspektive betrachtet … sinkt in manchen Ländern mit hoher Bevölkerungsdichte die Zahl der Raucher auf 10 bis 15 % der erwachsenen Bevölkerung. Allerdings leben die meisten erwachsenen Raucher mit anderen Menschen zusammen, und der Anteil der Haushalte, die Passivrauch ausgesetzt sind, liegt insgesamt bei etwa 40 bis 50 %. Selbst wenn jemand zu Hause nicht raucht (das entspricht einem Drittel der Weltbevölkerung), ist er dennoch betroffen, wenn er das Pech hat, in einem Gebiet mit hoher Umweltverschmutzung zu leben, in dem geraucht wird. In der heutigen Zeit, so Finch, seien alle Arten der Luftverschmutzung – sei es Rauchen, Smog oder alles, was mit dem Einatmen von Nanopartikeln einhergeht – zu einem neuen Forschungsgebiet geworden, um das Alzheimerrisiko der Menschen zu bestimmen. Er hat in seiner Forschung einige wichtige Fragen aufgeworfen und war begierig darauf, Antworten darauf zu finden. Ist Luftverschmutzung beispielsweise die Ursache für die Entstehung der Alzheimer-Krankheit oder beschleunigt sie lediglich deren Entstehung? Gelten seine umfangreichen Erkenntnisse über Frauen in gleicher Weise für Männer? Demenz ist heute die am meisten gefürchtete Alterskrankheit, vor allem, weil sie nach wie vor so weit verbreitet, so unerbittlich und so verheerend für das Leben der Betroffenen ist. Doch wie hat sich die Behandlungslandschaft für Demenz in den über hundert Jahren entwickelt, seit August Dettel zu seinem Psychiater gebracht wurde? „Ich denke, hier besteht eine enorme Chance, einen großen Beitrag zur Verringerung der weltweiten Belastung durch Demenz zu leisten“, sagte Dale Bredesen, ein praktizierender Arzt und Neurologe, der 1999 Gründungsdirektor des Buck Institute war. Warum ist Bridson so optimistisch? In den nächsten Kapiteln werde ich die heutigen Aussichten für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit untersuchen. Wir werden uns auch ansehen, wie sich andere Aspekte der Alterungsforschung in der Praxis entwickeln – von verkürzten Telomeren, seneszenten Zellen und einem gestörten Immunsystem bis hin zur dualen Natur bestimmter Gene für Gut und Böse und den schädlichen Auswirkungen freier Radikale. Und was müssen wir noch tun, um den Alterungsprozess des Menschen zu verlangsamen oder deutlich zu verbessern? Hinweise [1] In der Statistik bezeichnet die Metaanalyse eine statistische Methode, die die Ergebnisse mehrerer Studien kombiniert. In Bezug auf die Anwendung handelt es sich um eine neue Methode der Literaturrecherche. Die traditionelle Methode der Literaturrecherche ist die narrative, bei der der Autor frühere Studien auswählt, die er für wichtig hält. Wenn die Schlussfolgerungen verschiedener Studien widersprüchlich sind, entscheidet der Autor, welche Schlussfolgerung wertvoller ist. ——Anmerkung des Herausgebers |
<<: Was ist Vollmilch? Welche Vollmilchmarke ist gut?
Artikel empfehlen
Ein Bild zum Verstehen | Was ist der Unterschied zwischen Antigentests und Nukleinsäuretests?
Quelle: Beijing Health Education...
Wie isst man Cantaloupe-Melonen? Ist Cantaloupe-Melone ein alkalisches oder saures Lebensmittel?
Die Hami-Melone ist als „Königin der Melonen“ bek...
Welche Lebensmittel können Schlaflosigkeit heilen? Diätetische Methoden zur Behandlung von Schlaflosigkeit
Schlaflosigkeit ist ein Problem, mit dem jeder vo...
Welche Vorteile hat der Verzehr von gekeimtem Naturreis?
Viele Menschen essen im Alltag gerne braunen Reis...
Kann man immergrüne Pflanzen mit Milch gießen? Immergrün richtig mit Milch gießen
Milchguss auf Dieffenbachia Immergrüne Pflanzen d...
[Medizinische Fragen und Antworten] Welche topischen Medikamente gibt es zur Behandlung von Psoriasis?
Planer: Chinesische Ärztevereinigung Gutachter: H...
Stimmt es, dass der Huanan Seafood Market nicht der Ursprungsort des neuen Coronavirus ist? Wie entstand das Wuhan-Coronavirus?
Stimmt es, dass der südchinesische Fischmarkt nic...
Kann der Verzehr von zu vielen Kirschen zu einer Vergiftung führen? Die Wahrheit ist...
Tratsch „Der Verzehr von zu vielen Kirschen kann ...
Wie wäre es mit dem UK Now Magazine? Rezensionen zum UK Now Magazine und Website-Informationen
Was ist die Website des UK Now Magazine? Das briti...
Wie züchtet man Orchideen? Methoden und Vorsichtsmaßnahmen beim Orchideenanbau
Orchideen, auch Orchideengras genannt, sind wunde...
Gesundheit im Silberzeitalter | Soziale Betreuung und Unterstützung im Kontext des Alterns
Aufgrund der deutlich zunehmenden Alterung der We...
Plateau-Körperuntersuchung: Gesundheit schützen, Prävention geht vor
Autor: Yu Feifei, behandelnder Arzt des Spezialme...
Schichtarbeit raubt Ihnen nicht mehr den Schlaf! Vier Geheimnisse zur Verbesserung Ihrer Schlafqualität
Viele Berufe erfordern heute Schichtarbeit; Eine ...
Wie viele Jahre dauert es, bis ein Mangostanbaum Früchte trägt?
Einführung in das Pflanzen von Mangostanbäumen Ma...