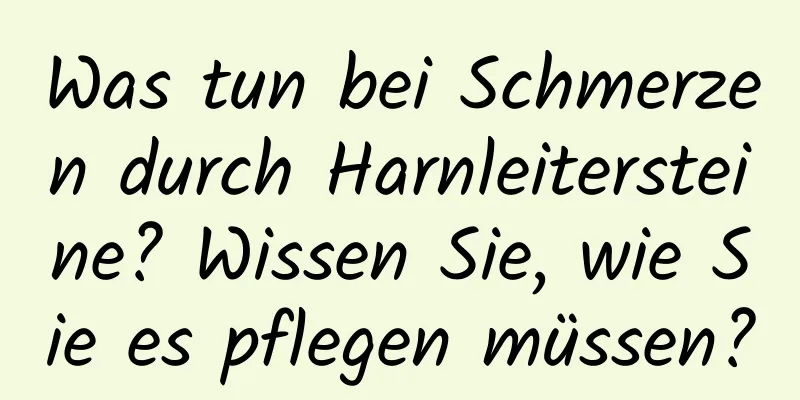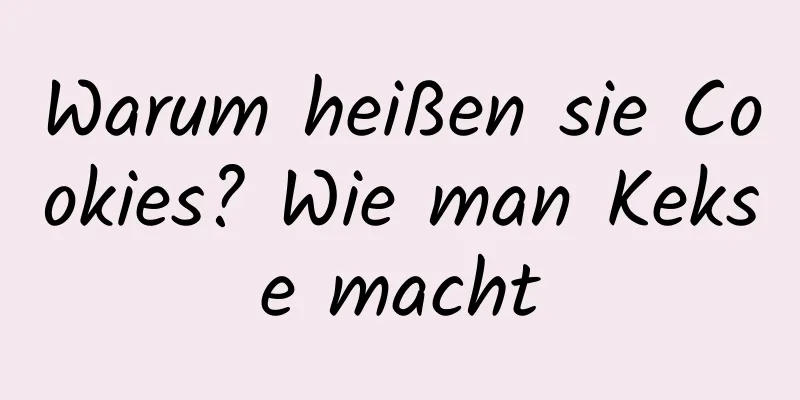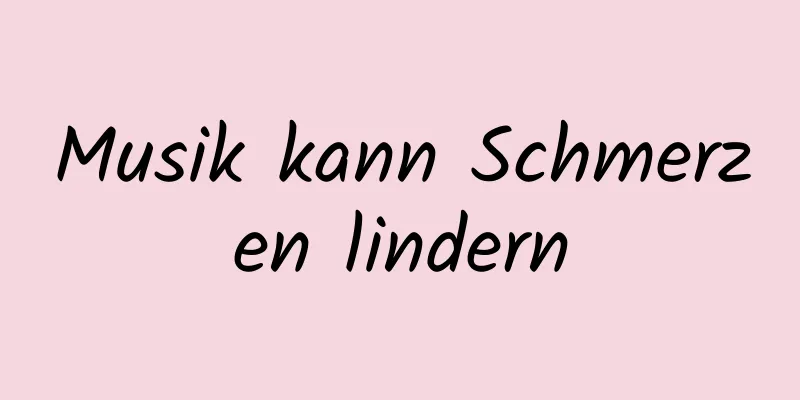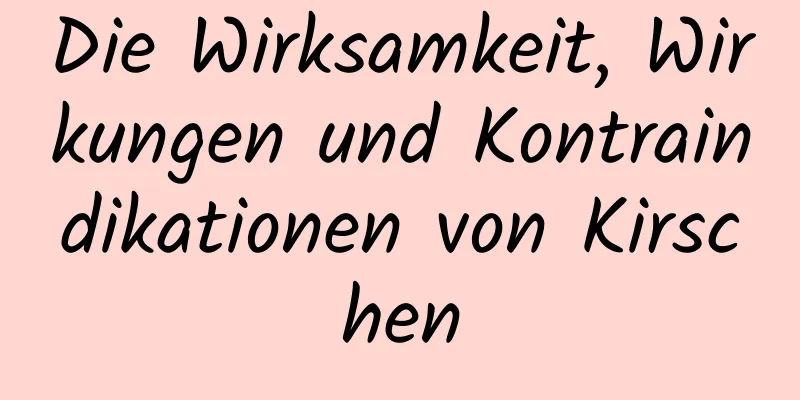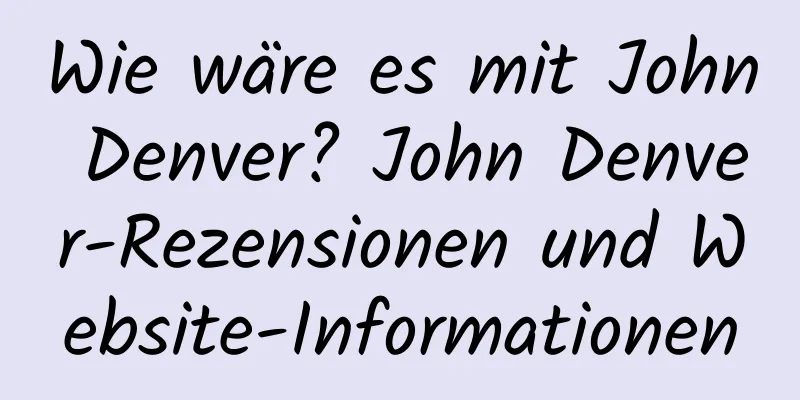Kognitive Neurowissenschaft: Selbst- und soziale Intelligenz

|
Selbst- und soziale Intelligenz ——Eine Person hat viele verschiedene soziale Selbstebenen und andere kennen sie durch diese verschiedenen Selbste. —William James, Principles of Psychology, Band 1, 1890, S. 294 ——Die Leute denken immer gerne analog über Probleme nach, ignorieren aber die zugrunde liegenden Prinzipien. – Elon Musk ——Die Grundfunktion des Gehirns ist Referenz, interne Referenz und externe Referenz. ——Kognitive Neurowissenschaft ——Wenn wir über die Komplexität des Gehirns staunen, müssen wir den Einfluss der Umgebung auf das Gehirn berücksichtigen, denn egal wie komplex das Gehirn ist, es ist nicht so komplex wie die Umgebung, der es ausgesetzt ist. ——Neuroökonomie ——Der IQ kann in einen fluiden IQ eingeteilt werden, d. h. in eine allgemeine Intelligenz, die nichts mit Wissen und Erfahrung zu tun hat; kristallisierter IQ, der die Größe des psychologischen Wörterbuchs hat; sozialer IQ und emotionaler IQ. ——Soziale kognitive Neurowissenschaft Vorwort: Eine der rätselhaftesten Fragen war schon immer: Was ist das „Selbst“? Einst wurde es auf die Ebene der Philosophie gehoben: Wer bin ich und wohin gehe ich? Wir werden in unserem Leben einem Typ Mensch begegnen, der über hohe kognitive Fähigkeiten verfügt, aber scheinbar nicht in der Lage ist, zwischenmenschliche Beziehungen zu führen. Die Art und Weise, wie andere uns kennen, kann sich völlig von der Art und Weise unterscheiden, wie wir uns selbst kennen. Sozialpsychologen interessieren sich sehr für die Wechselwirkung zwischen der inneren Selbstverarbeitung eines Individuums und seiner zwischenmenschlichen psychologischen Verarbeitung, was eigentlich das Ziel der sozialpsychologischen Forschung ist. Viele Menschen gehen naiv davon aus, dass die persönliche Souveränität nicht von anderen berührt werden kann und nicht von anderen beeinflusst wird, ebenso wie die absolute Freiheit, die manche Menschen für sich beanspruchen. Dann zeigte die Sozialpsychologie, dass die Entwicklung und Aufrechterhaltung des Selbst von der Situation geprägt wird, in der sie stattfindet. Schon vor Tausenden von Jahren wurde im Klassiker „Drei Charaktere“ die Bedeutung der Umgebung für die individuelle Entwicklung erklärt: „Wählen Sie Ihre Nachbarn gut aus.“ Mit anderen Worten: Die Menschen waren sich schon immer der Bedeutung der Umwelt für die Entwicklung und Erhaltung des Einzelnen bewusst. Wenn wir einfach verstehen, dass die Umwelt die Menschen formt und das Selbst die „Umwelt“ auf lokaler Ebene wählen kann, dann sollte sich die Beziehung zwischen dem Selbst und der Gesellschaft stärker auf die Gruppenformung der Gesamtumwelt und die Bedeutung individueller Entscheidungen in der lokalen Umgebung konzentrieren. Mit anderen Worten: Die Gestaltung der Umwelt ist für das persönliche Wachstum auf der Grundlage persönlicher Entscheidungen und die allgemeine Entwicklung auf der Grundlage politischer Maßnahmen von entscheidender Bedeutung. Tatsächlich ist die Wahrnehmung der Gesellschaft und der Welt ein persönlicher und subjektiver Prozess, der von den aktuellen Motivationen, Emotionen, Erkenntnissen und stabilen persönlichen Eigenschaften (wie Persönlichkeit, Selbstschema, Überzeugungen und Selbstüberzeugungen) des Einzelnen geprägt ist. Noch extremer ist die Interpretation der sozialen Wahrnehmung durch den Philosophen Nietzsche. Er geht davon aus, dass die Sicht eines Menschen auf die Gesellschaft (soziale Wahrnehmung) die Projektion seiner Eigenschaften auf die Welt ist: „Diejenigen, die meinen, etwas über mich zu wissen, interpretieren nur bestimmte Aspekte von mir entsprechend ihrem eigenen Selbstbild.“ Zu Beginn des Artikels haben wir ein Thema identifiziert, das diskutiert werden muss, nämlich die Prozesse der Selbsterkenntnis und sozialen Wahrnehmung und deren Beziehung. Selbsterkenntnis und soziale Wahrnehmung sind untrennbar miteinander verbunden, das heißt, die Umgebung formt das Selbst und formt so Selbsterkenntnis und soziale Wahrnehmung. Die Sozialpsychologie hat eine lange Geschichte und ist stark von der Gestaltpsychologie beeinflusst, wobei die Interaktion zwischen verschiedenen sozialen kognitiven Prozessen betont wird. Die vielfältigen Eigenschaften des Selbst Je nach sozialer Situation zeigen Menschen unterschiedliche Aspekte ihrer selbst. Daher sollten die neuronalen Mechanismen des Selbst genauso flexibel sein wie seine Verhaltens- und kognitiven Äußerungen, wenn es sozialem Druck ausgesetzt ist. In der Vergangenheit haben die Menschen das Glück erforscht. Allerdings beurteilen die Menschen ihr Glück im Leben erst im Nachhinein. Das retrospektive Situationsgedächtnis wird durch emotionale Salienz reguliert, d. h. Emotionen sind für das Situationsgedächtnis besonders wichtig. Dann wird eine gute Selbstdarstellung bzw. eine flexible Selbstdarstellung eine entscheidende Rolle für das Glück in verschiedenen sozialen Situationen spielen. 1. Selbst Der ventromediale Frontalkortex des menschlichen Gehirns ist besonders wichtig für die soziale Wahrnehmung und Selbstverarbeitung. Die Selbstverarbeitung umfasst hauptsächlich drei Aspekte: Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein und Selbstkontrolle. Selbstbewusstsein beinhaltet die Fähigkeit, sich selbst zu kennen und Informationen über die eigene Persönlichkeit, Vorlieben und Erfahrungen zu speichern. Selbsterkenntnis ist die Fähigkeit, die eigenen aktuellen Erfahrungen und Handlungen zu erkennen und zu reflektieren. Selbstkontrolle bezieht sich auf die Fähigkeit, sich strategisch anzupassen, um seine Impulse und Gewohnheiten zu überwinden. Wir wissen zum Beispiel, dass unsere Persönlichkeit nachdenklich ist und wir gerne allein sind, was Selbsterkenntnis ist; Wir sind uns bewusst, ob wir jetzt glücklich oder traurig sind und welche Auswirkungen unser aktuelles Verhalten hat, was Selbstbewusstsein bedeutet. Wir können unsere Emotionen kontrollieren und schlimme Folgen verhindern. Die Fähigkeit, schlechte Gewohnheiten zu ändern, ist Selbstbeherrschung. A. Selbstbewusstsein Selbstbewusstsein bezieht sich auf das Verständnis einer Person für ihre eigene Persönlichkeit, Hobbys und persönlichen Erfahrungen. Da es sich hierbei offensichtlich um subjektive Selbsteigenschaften handelt, ist die Selbstwahrnehmung sehr komplex. Das Sie, das andere kennen, und das Sie, das Sie kennen, können zwei völlig verschiedene Personen sein. In der Vergangenheit glaubten Psychologen, dass Menschen sich selbst eher durch ihr Verhalten als durch Selbstbeobachtung verstehen und dass wir auch andere auf diese Weise verstehen, das heißt, wir verstehen uns selbst und andere durch unser offensichtliches Verhalten, ohne die Wechselwirkung unserer eigenen und der intrinsischen Eigenschaftssätze anderer zu berücksichtigen. Doch die moderne Neuropsychologie hat bewiesen, dass nicht jede Selbsterkenntnis durch offensichtliches Verhalten entsteht. Viele Patienten haben keine Erinnerung an ihr eigenes Verhalten und ihr neues Verhalten kann keine Erinnerung erzeugen, aber sie können ihre Selbsterkenntnis trotzdem aktualisieren. Die sozialpsychologische Forschung zeigt, dass es ausreicht, wenn eine Person ihre Überzeugungen und Vorlieben ändert, wenn sie sich freiwillig für eine Handlung entscheidet, die ihren Überzeugungen und Einstellungen widerspricht. Dieser Vorgang wird als „Reduktion kognitiver Dissonanzen“ bezeichnet. Kognitive Dissonanz ist ein Zustand psychischer Belastung, in dem sich eine Person des Widerspruchs zwischen Verhalten und Überzeugungen bewusst ist. Überzeugungen sind auch der Grad der Selbstverpflichtung. Wenn die Überzeugungen einer Person zum Erfolg führen, das Verhalten jedoch nicht damit übereinstimmt, kommt es zu kognitiver Dissonanz. Doch Menschen ändern typischerweise ihre Überzeugungen, um ihr Verhalten anzupassen, statt ihr Verhalten zu ändern, um ihre Überzeugungen anzupassen. Mit anderen Worten: Menschen arbeiten an der Rationalisierung, um in ihren eigenen Augen und in den Augen ihrer Mitmenschen ein konsistentes Selbstbild aufrechtzuerhalten. Dies ist auch der Grund, warum die Überzeugungen der Menschen oft schwächer werden oder sich ändern. Und was noch wichtiger ist: Wenn andere denken, dass Sie eine Person mit bestimmten Eigenschaften sein sollten und Ihr aktuelles Verhalten nicht dazu passt, dann werden Sie Ihre Überzeugungen ändern und diese Überzeugung wird zwischen Ihrem Verhalten und den Erwartungen anderer hin- und herwechseln. Untersuchungen zeigen, dass sich die Selbstwahrnehmung der Menschen unmittelbar nach der Handlung ändert, auch wenn sie ihre Tat sofort vergessen. Dies zeigt, dass die Selbstwahrnehmung eine der Quellen der Selbsterkenntnis ist. Die Menschen müssen sich nicht mit komplexen, bewussten Überlegungen über ihr eigenes Verhalten beschäftigen. Ihr Verhalten wird sich automatisch in der Selbsterkenntnis und im Selbstbewusstsein widerspiegeln. Zumindest manchmal muss es sich um ein eher automatisiertes Ergebnis der Selbstbeobachtung handeln. B Neurokognitive Prozesse Zu den am häufigsten aktivierten Bereichen für die Selbstwahrnehmung gehören der Precuneus, der mediale präfrontale Kortex und der laterale temporale Kortex. Die Neurowissenschaft untersucht derzeit die Funktionen des Precuneus, die bisher nur unzureichend verstanden wurden. Die Funktionen, die durch die Interaktionen zwischen ihnen erfüllt werden, scheinen mit der Verarbeitung expliziten Wissens in Zusammenhang zu stehen. Der mediale präfrontale Kortex ist an der expliziten Zuschreibung der mentalen Zustände anderer beteiligt und kann daher auch an Selbstzuschreibungen beteiligt sein. Der Precuneus im Parietallappen spielt eine Rolle bei der Perspektivübernahme und dem Abruf kontextueller Erinnerungen, die einen von anderen unterscheiden. Der rechte inferiore Temporalkortex und der Temporalpol könnten bei der Speicherung deklarativen Selbstwissens eine Rolle spielen. Die Spekulationen über die Funktionen der Gehirnbereiche, die bei der Urteilsbildung im Rahmen der Selbstwahrnehmung am aktivsten sind, stehen im Einklang mit den Aussagen des Philosophen John Locke aus dem 17. Jahrhundert über die Rolle expliziter Denk- und Gedächtnisprozesse bei der Aufrechterhaltung der Selbstwahrnehmung. Locke schlug vor, dass „was wir sind, durch das bestimmt wird, was wir in der Vergangenheit getan oder gedacht haben, soweit sich unser Bewusstsein daran erinnern kann.“ Mit anderen Worten: Wenn sich eine Person nicht daran erinnern kann, was sie in der Vergangenheit getan hat, wie kann sie dann allgemein beantworten, was für ein Mensch sie ist? In diesem Modell der Selbsterkenntnis erinnern wir uns explizit an typische Verhaltensweisen aus der Vergangenheit und denken darüber nach, um festzustellen, ob diese Verhaltensweisen mit bestimmten Eigenschaften von uns selbst (wie etwa Großzügigkeit) übereinstimmen. Die Aktivierung des Precuneus, des medialen präfrontalen Kortex und des Temporallappens während der Beurteilung der Selbstwahrnehmung steht im Einklang mit diesem „evidenzbasierten“ Modell der Selbstwahrnehmungsverarbeitung. Neuroimaging-Studien stehen im Einklang mit dieser Forschung, die auf den folgenden zwei Annahmen basiert: (1) Menschen verfügen über mehrere Selbstwahrnehmungssysteme; (2) Einzelpersonen müssen bei der Selbstbeurteilung eine auf Beweisen beruhende Selbsterkenntnis erlangen. Wenn die neuronalen Systeme für die beweisbasierte Selbstwahrnehmung beschädigt sind, können sie andere Quellen der Selbstwahrnehmung nutzen. C Situative Faktoren Es gibt klare Hinweise darauf, dass das beweisbasierte Selbstwahrnehmungssystem nicht das einzige Selbstwahrnehmungssystem ist, das beim Menschen funktioniert. Über die Existenz dieser anderen Art des Selbstbewusstseins kann man jedoch nur spekulieren, und ihr Wesen ist noch immer unbekannt. Es scheint, dass die Erfahrungen der Menschen eine Art Abdruck hinterlassen. Neuere Forschungen legen nahe, dass eine andere Form der Selbstwahrnehmung auf intuitiven neuronalen Mechanismen beruhen könnte. Insbesondere kann zunehmende Erfahrung in einem Bereich zu einer allmählichen Verlagerung von der Abhängigkeit von beweisbasierter Selbsterkenntnis hin zur Abhängigkeit von intuitionsbasierter Selbsterkenntnis führen. Wenn Menschen sich in Bereichen ein Urteil über sich selbst bilden, in denen sie wenig Erfahrung haben, stützen sie sich auf beweisbasierte Selbstwahrnehmungen. In Bereichen, in denen sie vertraut sind, verwenden sie keine evidenzbasierten Selbstwahrnehmungen. Mit anderen Worten: Wenn eine Person Beweise finden muss, um sich auf einem bestimmten Gebiet zu beweisen, dann ist sie mit diesem Gebiet eigentlich nicht vertraut; Wenn eine Person hingegen über genügend Erfahrung und Selbstvertrauen auf einem bestimmten Gebiet verfügt, verlässt sie sich auf ihre Intuition. In Bereichen, die dem Einzelnen vertraut sind, aktivieren seine Intuition und sein Selbstvertrauen den ventromedialen präfrontalen Kortex, den Nucleus accumbens der Basalganglien, die Amygdala und den hinteren Parietallappen. Die Forschung zeigt jedoch nicht nur, dass die Selbstwahrnehmung auf mehreren Gehirnnetzwerken mit unterschiedlichen Komponenten basiert, sondern auch, dass diese Gehirnnetzwerke grundsätzlich unterschiedliche Funktionsweisen aufweisen. Zukünftige Forschung wird sich damit befassen, welche Gehirnnetzwerke bei der Selbsterkenntnis unter verschiedenen Kontexten, Motivationen, kognitiven Zuständen, Zielen und Existenzen verwendet werden. Selbsterkenntnis und Selbstreflexion Dabei wird das Selbst in das „objektive Selbst“, das auf Bezug, Bewertung und Zusammenfassung basiert, und das „subjektive Selbst“, das auf Gefühlen und Erfahrungen in der Gegenwart basiert, unterteilt. Anschließend werde ich das Thema in zwei Teile unterteilen: Selbstbewusstsein und Selbstkontrolle. Selbstkontrolle tritt ein, wenn das Selbst sich der Notwendigkeit einer Anpassung bewusst wird. Eine neuronale Assoziation Wenn Menschen Schmerzen haben, denken sie nie darüber nach, ob sie Schmerzen haben, sondern ob es jemand anderes ist, der Schmerzen hat. Dies ist Selbsterkenntnis, die auf Erfahrung beruht. Darüber hinaus tritt Selbstbewusstsein immer dann auf, wenn ein Konflikt auftritt, etwa wenn Menschen aufgefordert werden, Zahlen mit der linken Hand und Wörter mit der rechten Hand zu schreiben, weil wir keine konstante Wahrnehmung aufrechterhalten können. Das Selbstbewusstsein entsteht im Gyrus cinguli im Gehirn. Die Aktivierung des anterioren cingulären Cortex löst Selbstbewusstsein aus und initiiert kognitive, verhaltensbezogene und physiologische Reaktionen, um Konflikte zu minimieren. Wenn der vordere cinguläre Kortex ein Bottom-up-Selbstgefühl auslöst, dann löst der hintere Parietallappen ein indirektes Top-down-Selbstgefühl aus. Eine Schädigung des hinteren Parietallappens kann sich darauf auswirken, wie Patienten ihre Erkrankung erleben und erkennen. Wenn der durch äußere Situationen verursachte Konflikt das Selbstbewusstsein durch den Gyrus cinguli daran erinnern kann, auf sich selbst zu achten, dann wird der hintere Parietallappen das Selbstbewusstsein bei nicht-situativer Stimulation daran erinnern, auf sich selbst zu achten. B Neurokognitive Prozesse Das Selbstbewusstsein hinsichtlich eines Konflikts und die zur Überwindung dieses Konflikts erforderliche Selbstkontrolle treten häufig gleichzeitig auf und verstärken sich gegenseitig. Es wurde festgestellt, dass Selbstkontrolle den anterioren cingulären und präfrontalen Kortex aktiviert. Wenn jedoch Selbstkontrolle erforderlich ist, wird der Gyrus cinguli anterior aktiviert und der präfrontale Kortex wird aktiviert, um die Selbstkontrolle umzusetzen. Die Rolle des hinteren Parietallappens bei der Selbstwahrnehmung wird nach und nach entdeckt. Der hintere Parietallappen hat zwei typische Funktionen: eine ist die Aufrechterhaltung des nicht-exekutiven Arbeitsgedächtnisses und die andere die Durchführung räumlicher Verarbeitung. Zahlreiche Studien legen nahe, dass die Funktion des posterioren parietalen Kortex darin bestehen könnte, nicht-symbolische, parallele, diskrete Darstellungen in symbolische, lineare, lokale Darstellungen umzuwandeln. Das heißt, der hintere Parietallappen repräsentiert abstraktere Informationen, beispielsweise wie Menschen einzelne Wolken in bedeutungsvollen Formen visualisieren. Diese symbolischen Darstellungen tauchen allmählich aus einem unsichtbaren, unbemerkten Hintergrund auf, werden von uns wahrgenommen und bilden einen Bewusstseinsstrom. Beispielsweise bilden manche Menschen in einer Menschenmenge beim Gehen eine Form, und wir nehmen diese Form wahr und machen sie uns bewusst. Der Kernpunkt dieser Schlussfolgerung besteht darin, dass der hintere parietale Kortex vom ventralen Temporallappen und Okzipitallappen innerviert wird und dass die Funktion der beiden letztgenannten Gehirnregionen in der visuellen Verarbeitung liegt. Die visuellen Informationen im Okzipitallappen können bei der unbewussten Verarbeitung in Objekte und Kategorien dekodiert werden. Wenn also an der kritischen Schnittstelle zwischen Unterbewusstsein und Nicht-Unterbewusstsein ein Reiz empfangen wird, wird der hintere Parietallappen vorab aktiviert und der Reiz wird als bedeutsam wahrgenommen. Mit anderen Worten: Der Parietallappen verfügt über außergewöhnliche Bedeutungsassoziationen und Erkenntnisse bei der visuellen und grafischen Verarbeitung. Eine echte symbolische Verarbeitung kann für die Fähigkeit zur Perspektivübernahme von entscheidender Bedeutung sein. Symbole können für Aussagen verwendet werden, die explizit asymmetrische Beziehungen zwischen Entitäten darstellen. Bei der Perspektivübernahme kommt es auf die Darstellung asymmetrischer Zusammenhänge an und die Person, die die Perspektivübernahme vornimmt, muss ihre eigene Perspektive von der Perspektive der Zielaufgabe unterscheiden. Beim episodischen Erinnern versuchen Menschen, ihre eigene Perspektive aus einem Zeitpunkt in der Vergangenheit wiederzuerlangen, eine Form der Selbstperspektivenübernahme. Interessanterweise müssen Menschen ihre gegenwärtigen Perspektiven verdrängen, wenn sie sich an ihre früheren Perspektiven erinnern. Genauso wie wir uns auf die Perspektivübernahme einlassen müssen, um unser früheres Selbst wiederzuentdecken, müssen wir uns auch auf die Perspektivübernahme einlassen, indem wir unser gegenwärtiges Selbst bewusst verstehen. Es fällt uns schwer, unsere eigenen Fähigkeiten direkt einzuschätzen, doch Menschen verfügen über eine magische Fähigkeit: „Ich weiß nicht genau, wie schlau ich bin, aber ich kann klar beurteilen, wie schlau andere sind.“ Ebenso sind Menschen möglicherweise nicht in der Lage, sich selbst direkt zu verstehen, können sich jedoch ein Urteil über sich selbst bilden, indem sie sich von den Menschen in ihrer Umgebung leiten lassen, die bereits ein Urteil über sie gefällt haben. Wir sollten jedoch darauf achten, dass die Menschen unterschiedliche Persönlichkeiten kennen, und wenn wir uns selbst durch das Urteil anderer kennenlernen, sollten wir so vorsichtig wie möglich sein, um die Vielfalt des Selbst zu bewahren. Mit anderen Worten: In den Augen anderer sind wir unvollständig und wir sollten uns selbst so vollständig wie möglich kennen, um unsere Integrität zu bewahren. Insoweit dieser Prozess den Erwerb von Selbsterkenntnis darstellt, lässt er darauf schließen, dass: (1) die Generierung von Selbsterkenntnis ein grundsätzlich sozialer Prozess ist, der sich von der naiven Theorie des „introspektiven Erwerbs“ unterscheidet, die die meisten Menschen vertreten; und (2) die neuronalen Korrelate der Perspektivübernahme sollten für die Selbsterkenntnis von zentraler Bedeutung sein, da uns die Perspektivübernahme dabei helfen kann, Selbsterkenntnis zu generieren oder abzurufen. C Situative Faktoren Der Precuneus ist der Bereich, der bei der Selbstbeurteilung am häufigsten aktiviert wird. Diese Aktivierung spiegelt eine Kombination aus der Übernahme einer Selbstperspektive wider, um auf Informationen über das frühere Selbst und die wichtigen Selbstbewertungen anderer zuzugreifen. In dem Maße, in dem diese Perspektivübernahmeprozesse integriert sind, ist es nahezu unmöglich, die Selbstverarbeitung von der sozialen Verarbeitung zu trennen. Selbstkontrolle Verschiedene neuropsychologische Störungen haben gezeigt, dass Selbstkontrolle, also die Fähigkeit, die eigenen Impulse aus eigener Kraft zu beherrschen, mit dem lateralen präfrontalen Kortex und den Basalganglien zusammenhängt. Wenn der Precuneus und der Gyrus cinguli das Selbstbewusstsein aktivieren, dann sind die Basalganglien an der eher automatischen Selbstkontrolle beteiligt, die sich allmählich durch Gewohnheit aufbaut, und der präfrontale Kortex ist hauptsächlich an der Selbstkontrolle beteiligt, die Anstrengung erfordert. Ein neurokognitiver Prozess Der laterale Frontalkortex erfüllt bei der anstrengenden Selbstkontrolle mindestens drei neurokognitive Funktionen. Der laterale präfrontale Kortex ist mit dem Arbeitsgedächtnis und der Sprachverarbeitung verbunden, zwei Prozessen, die es dem Menschen gemeinsam ermöglichen, aus einer Reihe symbolischer Darstellungen neue Aussagen zu bilden und sich diese zu merken. Bei dieser Planungsfähigkeit handelt es sich um die menschliche Fähigkeit, sich mögliche zukünftige Situationen vorzustellen und die Konsequenzen von Impulsen zu bedenken. Obwohl wir unsere Impulse überwinden und andere flexible, kontrollierte soziale Verhaltensweisen und Strategien annehmen können, hat dies eindeutig seinen Preis. Das Spannende dabei ist, dass die Fähigkeiten des präfrontalen Kortex viele der gleichen Kontrolleigenschaften aufweisen wie das periphere motorische System: Mit der Zeit werden die Fähigkeiten zur Selbstkontrolle durch den Einsatz gestärkt, doch auf kurze Sicht ermüden sie oder werden durch Überbeanspruchung sogar völlig erschöpft, und kurze Phasen der Selbstkontrolle führen oft zu zunehmend schlechteren Ergebnissen. Die Aktivierung des präfrontalen Kortex führt durch drei verschiedene Rechenmechanismen zur Selbstkontrolle. Erstens können die Produkte der präfrontalen Aktivität – in Form von Schlussfolgerungen und Verhaltensabsichten – das motorische System direkt aktivieren und das motorische Verhalten des Einzelnen der Kontrolle stärker automatisierter neuronaler Prozesse entziehen. Die automatische Kontrolle des direkten Verhaltens ist zwar in neuen Umgebungen äußerst flexibel und nützlich, wenn sie jedoch kontinuierlich auf das Verhalten einwirkt, erfordert sie ständige Anstrengung und Konzentration. Darüber hinaus sind Schlussfolgerungen, die ausschließlich auf der Urteilskraft und Logik des präfrontalen Kortex beruhen, alles andere als perfekt und verschlimmern das Problem häufig. Untersuchungen zur Entscheidungsfindung zeigen, dass eine explizite Absicht bei der Entscheidungsfindung oft dazu führt, dass wichtige Informationen systematisch weggelassen werden, selbst wenn diese Informationen vorhanden sind. Eine zweite Möglichkeit, wie der präfrontale Kortex Selbstkontrolle herbeiführt, besteht darin, dass er die Aktivierung schwächerer Prozesse und Repräsentationen fördert und es ihnen ermöglicht, der Konkurrenz durch automatischere Prozesse und Repräsentationen zu begegnen. Mit anderen Worten: Die präfrontalen Lappen lenken die Aufmerksamkeit auf schwächere Prozesse. Der präfrontale Kortex hilft dem Menschen auch dabei, die Identität von Objekten zu bestimmen, die ihm aus unkonventionellen Winkeln präsentiert werden. Eine letzte Möglichkeit, wie die präfrontalen Lappen Kontrolle ausüben, besteht darin, unsichere Impulse und Darstellungen zu unterdrücken. Die Fähigkeit, bereits vorhandene assoziative Impulse zu überschreiben, beruht auf dem lateralen orbitofrontalen Kortex. Reaktionen, die versuchen, das dominante Verhalten zu unterdrücken, aktivieren den ventrolateralen präfrontalen Kortex. Dieses Ergebnis wurde auf den Bereich der emotionalen Selbstregulation ausgeweitet. Beim Unterdrücken starker Emotionen wird der ventrolaterale Frontalkortex aktiviert, der für die Stressregulierung entscheidend ist. Wenn ein Ereignis, das eine starke emotionale Reaktion hervorruft, von den Versuchspersonen verlangt, die Bedeutung des Ereignisses neu zu bewerten und zu rekonstruieren und dadurch negative Emotionen zu reduzieren, ist dies schon immer ein Thema der sozialpsychologischen Forschung gewesen. Es gibt Hinweise darauf, dass sich die entsprechenden Emotionen ändern, wenn sich die Bedeutung eines Ereignisses für eine Person ändert. Die angstbedingte Aktivierung der Amygdala war im Zustand „Aufmerksamkeit“ stärker, während die Aktivierung des ventrolateralen präfrontalen Kortex emotionale Reaktionen in der Amygdala hemmte. Dies wurde in Studien an Patienten mit bipolarer Störung nachgewiesen, bei denen eine verringerte ventrolaterale präfrontale Aktivierung während der Entscheidungsfindung darauf schließen lässt, dass einer der Gründe dafür, dass diese Patienten während manischer Zustände zunehmend impulsiv werden, darin liegt, dass der ventrolaterale präfrontale Kortex nicht in der Lage ist, diese Impulse zu hemmen. Auch der Placeboeffekt und die Selbstregulation durch Autosuggestion werden mit dem ventrolateralen präfrontalen Kortex in Verbindung gebracht. Anstrengende Versuche zur Selbstkontrolle sind mit Aktivitäten im ventrolateralen präfrontalen Kortex verbunden, aber die primären Gehirnregionen, die an der Selbstkontrolle beteiligt sind, können spontan eine Selbstregulierung auslösen. Mit anderen Worten: In früheren Studien übten die Menschen bewusst Selbstkontrolle aus, die offenbar durch den ventrolateralen präfrontalen Kortex reguliert wurde. Wenn der ventrolaterale Frontalkortex unerwünschte Impulse in der Amygdala und anderen Gehirnbereichen hemmen kann, dann sollte die Aktivierung des ventrolateralen präfrontalen Kortex allein ausreichen, um spontane emotionale Impulse zu hemmen, selbst wenn der aktuelle emotionale Zustand nicht unter Selbstkontrolle steht. Soziale Wahrnehmung Manchmal sind soziale Kognition und soziale Wahrnehmung fast synonym. Das Verstehen der Persönlichkeiten, Absichten, Überzeugungen und Identitäten anderer ist für Menschen möglicherweise die wichtigste Form der Wahrnehmung, um an sozialen Aktivitäten teilzunehmen. Ein Großteil der Forschung zur sozialen Kognition der letzten Jahrzehnte hat sich hauptsächlich auf die häufigen Fehler konzentriert, die sich aus diesen Prozessen ergeben. Bei den Prozessen der Attribution und der Stereotypisierung fällen Einzelpersonen Urteile über die Persönlichkeit, Einstellungen, Absichten und Moral anderer, wobei sich die Attribution auf das Verhalten und die Stereotypisierung auf Gruppen konzentriert. Die Identifizierung anderer hängt mit der Zuschreibung oder Bildung von Stereotypen zusammen, und die Entschlüsselung der Gefühlsausdrücke anderer ist ein weiterer wichtiger Bereich der sozialen Wahrnehmung. Namensnennung Attribution ist die einzigartige menschliche Fähigkeit, die Absichten, Überzeugungen, Wünsche und stabilen psychologischen Eigenschaften anderer zu verstehen. Wir können leicht schlussfolgern, dass der motivierteste Schüler fleißig ist, und wir können leicht schlussfolgern, dass eine traurige Person Schwierigkeiten hat. Sozialpsychologische Theorien beschreiben die Gesetze, die dazu führen, dass man aus beobachtetem Verhalten auf die Stimmungen und Charaktereigenschaften anderer schließen kann. Beispielsweise bestimmte Charakterzüge und eine stabile Persönlichkeit einer spuckenden Person. Doch bis zu einem gewissen Grad wird menschliches Verhalten durch Umweltnormen ausgelöst, sodass es unmöglich ist, Normen vom inneren Persönlichkeitspotenzial zu trennen. Es fällt uns schwer, die Ruhe der Studenten in der Bibliothek auf Umgebungsnormen oder ihre Persönlichkeit zurückzuführen. Wenn das Verhalten jedoch gegen die Norm verstößt, nehmen wir leicht Schuldzuweisungen vor. Gesunde Erwachsene führen das Verhalten anderer Menschen häufig auf ihre Persönlichkeit zurück, Autismus hingegen ist eine Entwicklungsstörung, die durch eine zunehmend verminderte Fähigkeit gekennzeichnet ist, auf die psychische Verfassung anderer Menschen zu schließen. Ein Typ hochfunktionaler autistischer Patient verfügt über einen IQ und kognitive Fähigkeiten, die sogar weit über denen gesunder Erwachsener liegen, aber er hat Schwierigkeiten, auf die mentale Verfassung anderer zu schließen. Daher können wir den Schluss ziehen, dass zwischen dem sozialen IQ und anderen IQs eine doppelte Dissoziation besteht. Mit anderen Worten: Wir neigen eher dazu zu glauben, dass sich eine Person auf eine bestimmte Art und Weise verhält, weil sie sich in einer bestimmten Situation befindet, als zu glauben, dass sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, weil sie über bestimmte stabile Persönlichkeitsmerkmale verfügt. Bei Drogenabhängigen ist man gewohnt, dies immer auf problematische Eigenschaften der Person zurückzuführen. Auch wenn wir den Leuten sagen, dass es sich um einen guten Menschen handelt, glauben sie dennoch, dass der Drogenmissbrauch auf die schwache Willenskraft dieser Person zurückzuführen ist. Wie bereits erwähnt, sind Normen und Persönlichkeit jedoch untrennbar miteinander verbunden. Logischerweise kann man daraus nicht schließen, dass die Persönlichkeit einer Person gut ist, nur weil sie keine Drogen nimmt, und auch nicht, dass die Persönlichkeit einer Person problematisch ist, nur weil sie Drogen nimmt. Wir müssen das eingangs Erwähnte berücksichtigen, nämlich dass die Entwicklung und Erhaltung eines Individuums das Ergebnis der Umwelteinflüsse ist. Tatsächlich ist es wahrscheinlicher, dass das Verhalten eines Individuums eher das Ergebnis der Umwelteinflüsse ist als der Einfluss seiner Persönlichkeitsmerkmale. Wir sind immer bereit zu glauben, dass das, was der Autor schreibt, seine Gedanken widerspiegelt. Selbst wenn uns jemand sagt, dass der Autor gezwungen war, diese Meinung zu schreiben, werden wir dennoch denken, dass es seine Meinung ist. Wir glauben lieber, dass die Armut der Armen das Ergebnis ihrer mangelnden Anstrengung ist, statt zu glauben, dass die Armut durch die Umgebung verursacht wird, in der sie leben. Diese Fähigkeit, Schuld zuzuweisen, erstreckt sich sogar auf uns selbst – wir ignorieren den Einfluss der Umwelt auf uns selbst und geben uns immer selbst die Schuld dafür, dass wir nicht hart genug arbeiten. Dieses Phänomen wird als Korrespondenzverzerrung oder fundamentale Attributionsverzerrung bezeichnet. Das bedeutet, dass Menschen, wenn sie das Verhalten anderer auf ihre Persönlichkeitseigenschaften zurückführen, dazu neigen, dieses Verhalten anderen zuzuschreiben und die Rolle bekannter situativer Faktoren bei diesem Verhalten unterschätzen. Wenn die Fähigkeit, auf den Geisteszustand anderer zu schließen, bei Menschen mit Autismus unterentwickelt ist, dann ist die Fähigkeit, auf den Geisteszustand anderer zu schließen, bei gesunden Erwachsenen überentwickelt und ihre Vorurteile lassen sich nicht so leicht abmildern. Sozialpsychologen glauben, dass der Korrespondenzfehler dazu führt, dass wir die Verantwortung für Ereignisse immer einzelnen Personen zuschreiben, selbst wenn diese lediglich Opfer der Umstände sind. Wenn es beispielsweise um die Legalisierung von Marihuana in den Vereinigten Staaten geht, neigen die Menschen immer dazu, dies den „schlechten Entscheidungen“ bestimmter Politiker zuzuschreiben. Ein neurokognitiver Prozess Der Attributionsprozess von Menschen kann in chronologischer Reihenfolge in drei Phasen unterteilt werden: Verhaltensklassifizierung, Persönlichkeitscharakterisierung und Korrektur. Wenn es beispielsweise einen Schüler gibt, der im Unterricht schläft, wird das Verhalten des Schlafens im Unterricht zunächst als unangemessen normativ eingestuft und dann auf Persönlichkeitsmerkmale zurückgeführt, weil man denkt, der Schüler achtet nicht auf die Disziplin im Unterricht und lernt nicht gern. Schließlich werden sie Korrekturen vornehmen, um festzustellen, ob es daran liegt, dass er gestern Abend zu lange gelernt hat, zu viel Druck hatte und nicht gut geschlafen hat, was dazu geführt hat, dass er im Unterricht nicht durchhalten konnte. Die Kalibrierung ist der Schlüssel zu diesem Modell. Dabei werden mehr kognitive Ressourcen und Energie mobilisiert als in den beiden vorherigen Phasen. Wenn der kognitive Kanal blockiert ist, das Wissen unzureichend ist, Emotionalität, Müdigkeit, Denkträgheit, kognitive Fixierung oder andere Gründe vorliegen, schlägt die Korrektur fehl. Mit anderen Worten: Es erfordert geistige Anstrengung und den Wunsch nach Genauigkeit, damit der Einzelne situative Faktoren berücksichtigen kann. Da diese Ressourcen im Alltag oft fehlen, kommt es häufig zu einem Korrespondenzbias. Unter der Bedingung kognitiver Belastung werden die Klassifizierung und Zuordnung in den ersten beiden Phasen nicht beeinträchtigt, eine Korrektur wird jedoch schwierig. Um die Auswirkungen situativer Faktoren auf das menschliche Verhalten umfassend berücksichtigen zu können, müssen wir daher die kognitive Belastung verringern, über eine gute emotionale Kontrolle, mehr Wissen und Erfahrung sowie flexiblere kognitive Methoden verfügen. In neurowissenschaftlichen Modellen der sozialen Kognition hängt die Korrekturphase von der Aktivierung des lateralen präfrontalen Kortex ab, da dieser mit geistiger Anstrengung und der Verwendung der Aussagenlogik in Verbindung gebracht wird. Wenn Menschen einem unbelebten Zeichentricktier eine Persönlichkeit zuschreiben und daraus auf seine Persönlichkeit und Absichten schließen, verwenden sie verallgemeinerte Darstellungen, um nicht-propositionale Schlussfolgerungen zu ziehen und verwischen die Unterscheidung zwischen dem aktuellen Verhalten des Handelnden und den Verhaltenstendenzen seiner Persönlichkeit. Mit anderen Worten: Wenn die Beziehung zwischen dem Verhalten einer Person und dem Handelnden vage ist, kommt es zu erzwungenen Zuschreibungen, und erzwungene Zuschreibungen führen zu einem Korrespondenzbias. B. Situative Faktoren Situative Faktoren können den Attributionsprozess verändern. Menschen führen ihr eigenes negatives Verhalten eher auf die Situation zurück als auf das negative Verhalten anderer. Unter dem Begriff „Eigennützigkeitsvorurteil“ versteht man die Tendenz einer Person, ihre eigenen Probleme auf Umweltfaktoren und die Probleme anderer auf ihre Persönlichkeit zurückzuführen. Eine eigennützige Voreingenommenheit kann zu positiven Illusionen führen, etwa dem Eindruck, ich sei immer besser als andere. Die Basalganglien sind an der automatischen Verarbeitung positiver Emotionen und der automatischen Verarbeitung des Selbstbewusstseins beteiligt. Die Studie ergab, dass negatives Verhalten von Mitgliedern einer anderen Gruppe eher auf ihren angeborenen Charakter zurückzuführen ist als das von Mitgliedern der gleichen Gruppe. Eine eigennützige Voreingenommenheit kann sich über das physische Selbst hinaus auf Mitglieder derselben Gruppe wie das eigene Selbst oder auf andere Personen erstrecken, mit denen das Individuum Empathie empfindet. Mit anderen Worten: Wir neigen dazu zu denken, dass das negative Verhalten von Menschen unserer eigenen Rasse oder von Menschen, mit denen wir mitfühlen, durch die Umgebung verursacht wird, während das negative Verhalten von Menschen anderer Rassen oder von Fremden ein Problem ihres eigenen Charakters oder ihrer eigenen Verantwortung ist. Empathie ist ein zentraler Kontextfaktor der sozialen Intelligenz, der Attributionsprozesse vermitteln kann. Die Voraussetzung für Empathie besteht darin, die Emotionen der anderen Person erkennen und genauso empfinden zu können. Die Forschung zur Empathie in den kognitiven Neurowissenschaften steht noch ganz am Anfang, hat aber bereits bewiesen, dass das emotionale System über neuronale Mechanismen verfügt, die den Spiegelneuronen im motorischen System ähneln – wir können die Emotionen anderer simulieren. In der Philosophie und Sozialpsychologie wird Empathie seit langem erforscht. Empathie ist ein Schlüsselfaktor für die Entstehung prosozialen Verhaltens und prosozialer Wahrnehmung. Neuere Studien haben ergeben, dass Aufgaben, die Empathie und das Urteilen von Vergebung erfordern, eine Aktivierung des Precuneus bewirken können, während dies bei anderen sozialen Urteilen nicht möglich ist. Der Precuneus und der gesamte Parietallappen werden am kritischen Punkt der unterbewussten und bewussten Sinnbildung aktiviert. Dies macht logischerweise Sinn, da die Grundlage des menschlichen sozialen Verhaltens auf Empathie und der nach Empathie erzeugten Bedeutung basiert. Darüber hinaus basiert das Selbstbewusstsein auf der Bewertung der Positionen anderer Menschen, daher hängt unser Verständnis von uns selbst davon ab, wie andere sich selbst behandeln und ob wir ihren Standpunkt verstehen können. Das Precuneus wird in den meisten Studien zur Selbstbewusstsein aktiviert und ist an der Perspektive beteiligt, eine Voraussetzung für Empathie. Indem wir uns in andere einfühlen, können wir positivere und tolerantere Zuschreibungen über die Absichten hinter ihrem Verhalten machen. Obwohl Selbstwahrnehmung und soziale Wahrnehmung unterschiedliche Prozesse sind, sind sie tief miteinander verflochten. Ohne eine Selbstwahrnehmung und soziale Wahrnehmung kann der andere nicht gut verstanden werden. Im Fähigkeitsbereich kann nur der Erfolg als Kompetenz angesehen werden, da die Kompetenz als notwendige Voraussetzung für den Erfolg angesehen wird, während das Scheitern durch viele Situationsfaktoren verursacht werden kann. Die moralische Zuschreibung unterscheidet sich von anderen Arten der absichtlichen Zuschreibung. Die Menschen glauben, dass es für eine Person verständlich ist, aufgrund bestimmter Dinge gegen die Moral zu verstoßen, aber ohne Grund gegen die Moral zu verletzen, wird auf persönliche Qualitätsprobleme zurückgeführt. Moralische Zuschreibungen können daher durch andere Hirnregionen wie den orbitofrontalen Kortex moduliert werden. Stereotyp In allen Aspekten des Lebens verwenden Menschen häufig die Mitgliedschaftsklassifizierung, um ihre nächsten Handlungen zu leiten. Um es in chinesischen kulturellen Begriffen zu beschreiben, sind die Menschen daran gewöhnt, andere Menschen in unterschiedliche Ebenen aufzuteilen, was die neuropsychologische Grundlage von Stereotypen ist. Die Menschen haben keine Stereotypen über Papierklammern und Glühbirnen, da sie keine emotionale Aktivierung für Objekte haben, aber Emotionen über Glühbirnen in Europa und Glühbirnen, die in Afrika erzeugt werden, basierend auf der Identitätsverarbeitung hinter ihren Attributen, die erzeugt werden. Der größte potenzielle Schaden von Stereotypen ist jedoch für sich selbst, da Menschen, die Stereotypen über andere Gruppen haben, wahrscheinlich auch Stereotypen über sich selbst bilden. Wir sollten uns mehr um die Stereotypen kümmern, die Gruppen, die oft verantwortlich gemacht werden, sich über sich selbst bilden. Stereotypen beinhalten häufig negative Verallgemeinerungen über die Intelligenz, Fähigkeiten und moralische Eigenschaften von Gruppenmitgliedern. Das heißt, Stereotypen über Rasse, Geschlecht, Alter und sexuelle Orientierung beinhalten häufig emotionale Komponenten, die in Eindrücken von Objekten nicht vorhanden sind. Und im Gegensatz zu Objekten können Menschen gegen die ihnen auferlegten Stereotypen wehren. Gruppen, die von einem bestimmten Etikett stigmatisiert werden, sprechen sich häufig gegen die ihnen auferlegten Stereotypen aus. Leider entwickeln die Mitglieder dieser stigmatisierten Gruppen (wie Substanzabrechnung, sogenannte Drogenabhängige, Afroamerikaner, asiatische Amerikaner und arabische Amerikaner), nachdem sie beschuldigt oder "definiert" wurden oder "definiert" wurden, Selbstzweifel und entwickeln dann Stereotypen über sich selbst. Dieses Selbstbewusstsein kann tatsächlich zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen führen und letztendlich diese Stereotypen beweisen, die überhaupt nicht wahr waren. Zum Beispiel dürfte ein Drogenabhängiger, der kritisiert wird, wahrscheinlich Selbstzweifel haben und dann auf das schwierige Leben aufgibt, mit dem er sich befassen sollte. Zu diesem Zeitpunkt werden Emotionen zu irrationalem Verhalten führen, das die Erwartungen und Vorhersagen anderer weiter "verifizieren" wird. Mit anderen Worten, die beiden grundlegenden Denkweisen an Menschen sind: deklaratives Denken und regelbasiertes Denken. Das heißt, wenn jemand feststellt, dass Drogenabhängige ein Problem des Diebstahls haben, suchen die Menschen automatisch, ob diese Beschreibung korrekt ist. Diese Beschreibung ist jedoch voreingenommen, ihr Überprüfungsergebnis stimmt jedoch mit der Beschreibung überein. Einige Drogenabhängige haben ein Problem des Diebstahls, aber sicherlich nicht alle. Sobald die Leute die Tatsache überprüfen, dass "Drogenabhängige stehlen", wird die zweite Denkweise entstehen, was regelbasiertes Denken ist. Die Regel ist, dass "Drogenabhängige definitiv stehlen werden", weil sie einen Punkt verwenden, um eine Gruppe zu verallgemeinern, und diese Denkweise ist mehr arbeitssparend. Die Folge des regelbasierten Denkens ist jedoch, dass, wenn wir beweisen wollen, dass Drogenabhängige gute Menschen sind, nur die gesamte Gruppe von Drogenabhängigen nicht stiehlt. Ansonsten denken die Leute, dass der Vorschlag nicht wahr ist. Leider verweigern sich Drogenabhängige oft, bis sie sich selbst perfekt machen. Da es unmöglich ist, perfekt zu werden, fallen sie oft in ständige Selbstverleugnung, was einen Teufelskreis bildet, der durch ihre Denkweise verursacht wird. Auch nach dem Aufhören von Drogen können Drogenabhängige den Stereotypen anderer und sich selbst immer noch nicht entkommen - genau wie diese "intelligenten Menschen" beschrieben, es sei denn, sie sterben, sie werden ihr ganzes Leben lang Drogenabhängige sein. In einer freien Gesellschaft erkennen die Menschen, dass diese negativen sozialisierten Verallgemeinerungen zutiefst schmeichelhaft sind, und so geben sie nicht zu, dass sie in der Öffentlichkeit voreingenommen sind, genauso wie niemand sagen würde, dass sie gegen Drogenabhängige voreingenommen sind. Es gibt jedoch zahlreiche Beweise dafür, dass Menschen immer noch negative Stereotypen in ihrer Wahrnehmung und ihrem Verhalten haben. Daher erfordert das selbstregulierende voreingenommenes Verhalten viel Aufwand. Zusammenfassend sind Stereotypen so allgegenwärtig, dass Menschen, die egalitäre Ansichten haben, implizite Stereotypen ausdrücken können, selbst wenn sie sie nicht bewusst halten. Implizite Stereotypen sind in gewisser Weise schädlicher, weil sie nicht gehemmt werden müssen. Mit anderen Worten, der Grund, warum ein dunkles Herz dunkel ist, ist, dass es im Herzen wild wachsen kann, ohne durch das Feedback der Welt gehemmt zu werden. Die Studie zeigte, dass sowohl Schwarze als auch Weiße eine größere Aktivierung in der Amygdala beim Betrachten von Fotos von Schwarzen erlebten und dass die Aktivierung von Amygdala mit Verhaltensdaten zur impliziten Stereotypisierung zusammenhängt. Entscheidend ist, dass die Bildung impliziter Stereotypen das Ergebnis wiederholter negativer Darstellungen stigmatisierter Gruppen in Schulen, den Medien und anderen Ländern sein kann-negative Darstellungen, die nicht eine tiefe Prüfung von anderen hervorrufen, sondern zu einer Zuschreibung und Stereotypbildung führen. Noch interessanter ist, dass Menschen, wenn Menschen erkennen, dass Emotionen die normale Verarbeitung von Informationen beeinträchtigen, wenn Menschen gegen sich selbst voreingenommen sind und wenn Menschen depressiv sind, den frontalen Kortex verwenden, um emotionale Reaktionen und voreingenommene Ansichten zu unterdrücken. Dieser Ruf des frontalen Kortex wird den normalen Arbeitsprozess des frontalen Kortex besetzen, wodurch der Informationskanal des Frontalkortex überfüllt ist. Die Besetzung dieses Prozesses wirkt sich auf den Verlust der nachfolgenden Verarbeitung aus. Daher können sowohl Vorurteile als auch Emotionen das normale Denken des Gehirns beeinflussen. Es ist erwähnenswert, dass Selbstschemas als implizite Selbststereotypen beschrieben werden können. Zusammenfassung Ohne soziale Wahrnehmung kann es keine Selbstverarbeitung geben. Die soziale Wahrnehmung und die Fähigkeit, die Ansichten anderer zu erhalten, sind nicht nur der Beginn der Selbstbildung, sondern auch der Schlüssel zum Konstruktion und Aufrechterhalten des Selbst zu unterschiedlichen Zeiten. Das Selbst ist ein stabiles Objekt. Dies ist ein Trend, den nicht nur Wissenschaftler glauben, sondern jeder mit Selbstbewusstsein und unabhängigem Bewusstsein würde zustimmen. Im Laufe der Zeit ändert sich das Selbst und wird zumindest teilweise umgebaut, um sich an Situationen und Beziehungen anzupassen. Die soziale Wahrnehmung variiert auch je nach Perspektive des Einzelnen, und im Gegensatz zu einigen Arten der Wahrnehmung ist die soziale Wahrnehmung hoch motiviert. Soziale Reize sind oft mehrdeutig, und unsere Interpretation von ihnen wird oft von eigennütziger Verzerrung beeinflusst. |
>>: Was ist Mochi? Was sind die Zutaten von Mochi-Premix-Pulver?
Artikel empfehlen
Die Vorteile des Verzehrs wilder Bananen
Bananen gehören zu den am häufigsten verzehrten F...
Wie verwendet man Hot Pot-Öldip? Welche Art von Öl wird für Hot Pot Dip verwendet?
Ähnliche Gerichte gibt es auf der ganzen Welt, si...
Pflanzbedingungen und Klimaanforderungen für Ebereschen mit schwarzen Früchten
Pflanzbedingungen für Ebereschen mit schwarzen Fr...
Wie man Zuckerrohr anbaut, um es knackig und süß zu machen (Anbaumethoden und Anbautechniken für Zuckerrohr)
Wie man Zuckerrohr anpflanzt und pflegt In der Ji...
Nehmen Sie Knöchelverstauchungen nicht auf die leichte Schulter!
Eine Knöchelverstauchung, auch als „verstauchtes ...
Der erste im Inland produzierte Gürtelrose-Impfstoff ist offiziell auf dem Markt! Anwendbare Alterserweiterung der Bevölkerung
Am 3. Juni gab Changchun Biotech Co., Ltd. (nachf...
Die Wirksamkeit und Funktion von wildem Weißdorn
Wilder Weißdorn ist reich an Vitaminen und organi...
Ist es einfach, Gardenien in Töpfen zu züchten? Wie man Gardenien zu Hause anbaut
Ist es einfach, Gardenien in Töpfen zu züchten? G...
Der Verzehr von Grapefruit kann den Cholesterinspiegel senken
Kann der Verzehr von Grapefruit im Herbst den Cho...
Was ist mit LinkPrice? LinkPrice-Bewertungen und Website-Informationen
Was ist LinkPrice? LinkPrice: Der koreanische Medi...
Wie wäre es mit der Toyota Tsusho Corporation? Toyota Tsusho Corporation Bewertungen und Website-Informationen
Was ist die Website der Toyota Tsusho Corporation?...
Unterschiede zwischen weißen Kidneybohnen und weißen Linsen
Weiße Kidneybohnen und weiße Linsen sind beides i...
Für den Innenanbau im Norden geeignete Topfobstbäume (welche Obstbäume eignen sich für den Anbau in nordöstlichen Häusern)
Im Nordosten Chinas können viele Obstsorten in Tö...
Wie lässt sich die Qualität von Milchpulver anhand der Zutatenliste beurteilen? Kann ich die Milchpulvermarke häufig wechseln?
Milchpulver ist eine Art Instantnahrung aus frisc...