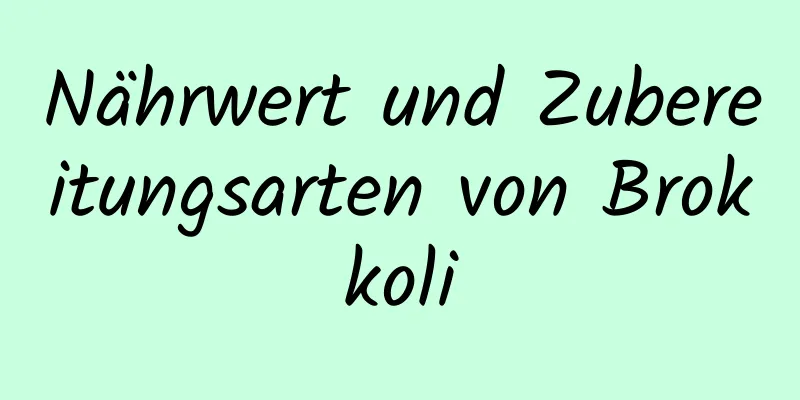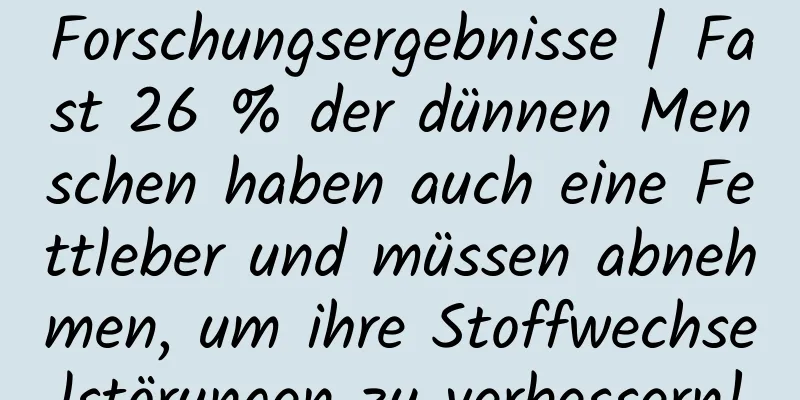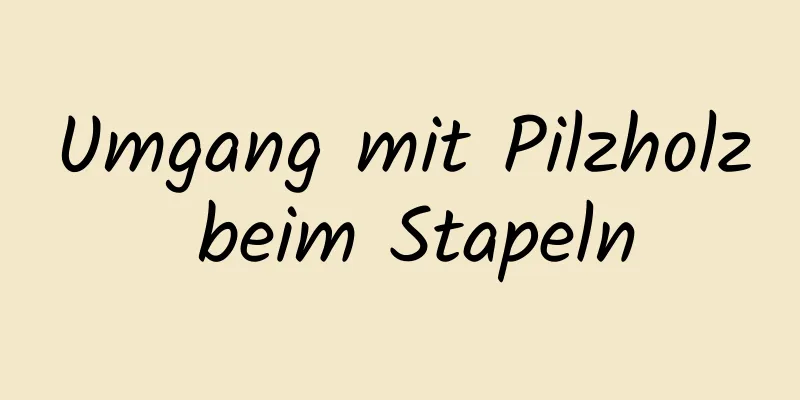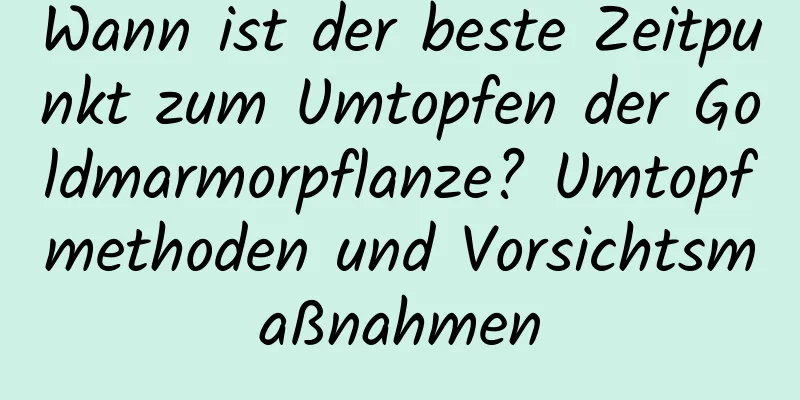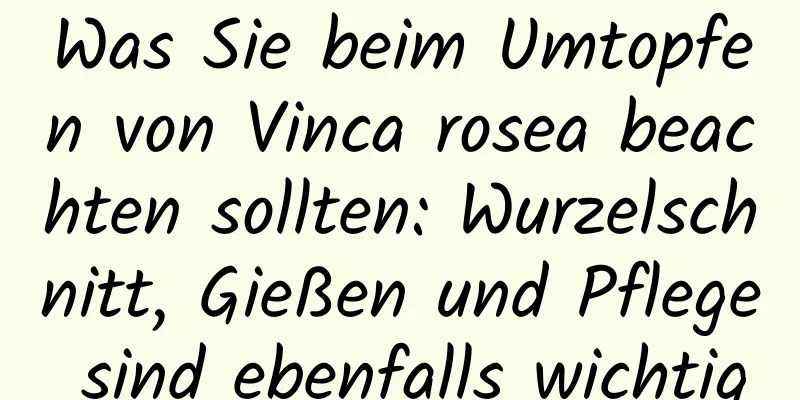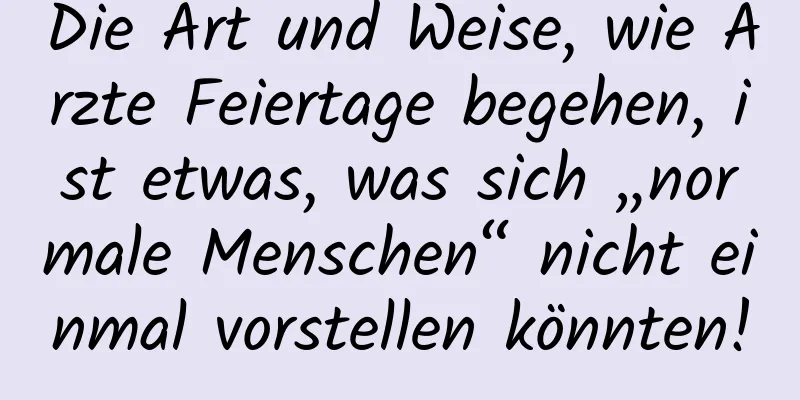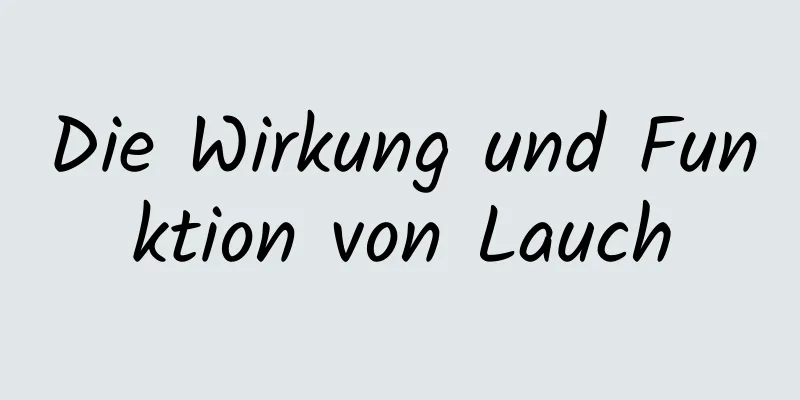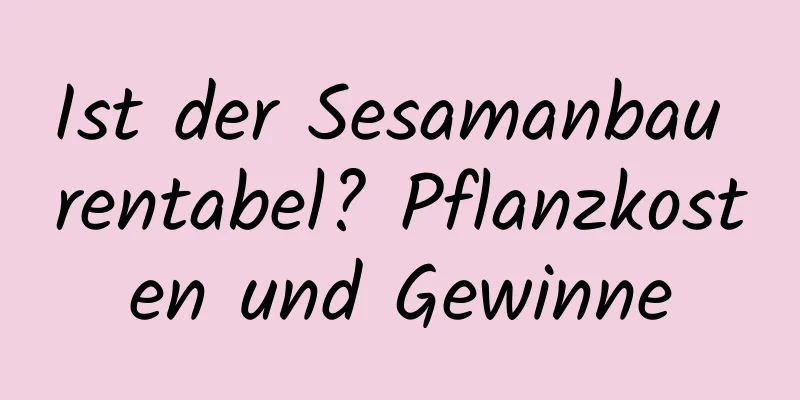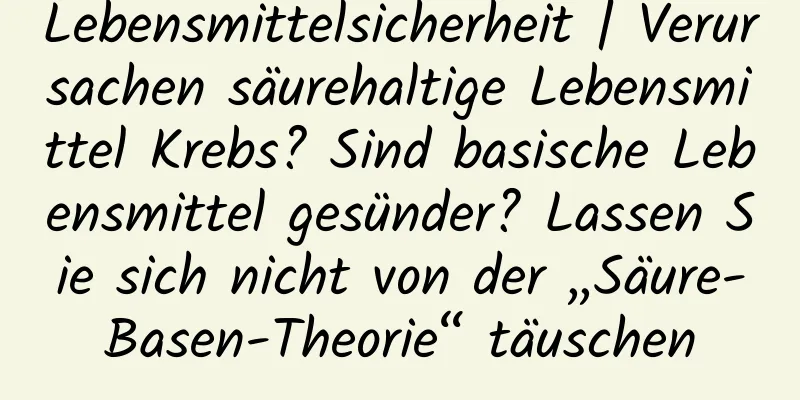Das olfaktorische Paradoxon: Die Geschichte eines gestrandeten Wals
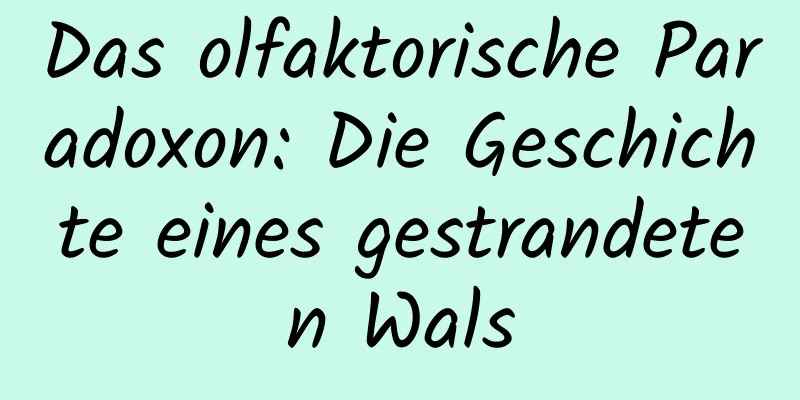
|
Leviathan Press: In „Tausendundeine Nacht“ wird eine Ambraquelle auf einer unbekannten Insel beschrieben. Der wachsartige Ambra floss mit einem wohlriechenden Geruch ins Meer, wurde von Walen gefressen und dann herausgespritzt und kondensierte auf der Meeresoberfläche zu Ambra. Es ist schade, dass Mythen nur Mythen sind und die Geburt von Ambra in Wirklichkeit alles andere als romantisch ist. Obwohl die Behauptung, Ambra stamme aus Walerbrochenem, noch immer umstritten ist, gibt allein die Tatsache, dass es mit dem Kot ausgeschieden wird, Anlass zur Vermutung. Ebenso interessant wie das „olfaktorische Paradoxon“ ist, dass der Wal explodierte. Am 29. Januar 2004 strandete ein 17 Meter langer und über 60 Tonnen schwerer Pottwal in Tainan, Taiwan. Der Wal explodierte, während die Forscher ihn auf einem Anhänger transportierten, und Hunderte von Zuschauern waren sofort mit Blut, Fett und inneren Organen bedeckt... Wenn Sie also in Zukunft das Glück haben, die folgende Szene am Strand zu sehen, bleiben Sie am besten fern und schauen Sie zu: ein schlechtes Omen Im 17. Jahrhundert wurden Wale unterschiedlicher Arten und Größen an die niederländische Küste gespült. Manchmal sind die Körper der Kreaturen bereits von Fäulnis befallen; Manchmal bleiben sie lebendig am Strand zurück, stöhnen ohrenbetäubend und werden von ihrem eigenen Gewicht erdrückt. Beim Zerfall bilden sich Gase, die manchmal zu übelriechenden Explosionen führen. Wenn die Flut den Wal nicht wegträgt, wird die Zersetzung des Kadavers und die Beseitigung der Trümmer ein langer und mühsamer Prozess sein. Diese riesigen Kreaturen zogen Zuschauer an, die von dem Schauspiel fasziniert waren, und Künstler versteckten sich in der Menge, trugen ihre Malutensilien bei sich und hielten fest, was sie sahen und rochen. Jan Sarnredam hat einmal einen am 19. Dezember 1601 gestrandeten Pottwal dargestellt (das Bild am Anfang dieses Artikels). Der Pottwal war gestrandet und lag auf der Seite, mit dem Bauch zum Ufer gerichtet. Scharen von Touristen versammelten sich um den aufgeblähten Walkadaver und kletterten auf seinen Körper, um ihn aus der Nähe betrachten zu können. Der beschreibende obere Rand beschreibt außerdem den Zustand des Wals mit seinem weit aufgerissenen Maul auf der linken Seite und seinem aufgerissenen Rücken auf der rechten Seite, aus dem seine Eingeweide quellen. Sarnredam zeichnete sich auch selbst. Er stand in der Nähe des Walmauls und kopierte den Kadaver des Wals auf ein Stück Papier, das in der Meeresbrise raschelte. In der Mitte des Bildes steht Graf Ernst Kasimir von Nassau-Dietz, ein Heerführer und Neffe von Prinz Moritz von Nassau, dem Regenten der Vereinigten Provinzen der Niederlande. In seiner linken Hand hielt er ein mit Quasten verziertes Taschentuch, das er sich vor die Nase hielt, um den Gestank auszusperren. Der niederländische Schriftsteller und Dichter Theodorus Schrevelius schrieb über das Ereignis ein lateinisches Gedicht, das den Gestank heraufbeschwört: „Seine Form war verloren, seine Öffnung reichte tief in seine Eingeweide und sein Mund: Flüssigkeit und große Mengen Blut strömten daraus hervor.“ „ Das Gemälde zeigt, wie die Eingeweide des Wals aus seinem Maul und Rücken quellen und dass er außerdem einen üblen Geruch verströmt. Angesichts des Gestanks, der vom Körper des Wals ausging, schien das Taschentuch des Grafen nutzlos. Ausschnitt aus „Der gestrandete Wal von Beverwijk“, Jan Saenredamm, 1602. Dieser Ausschnitt zeigt Saenredamm selbst bei der Skizze eines Wals (links), der herausquellenden Eingeweide und eines Taschentuchs, das Graf Ernst Casimir von Nassau-Dietz benutzte, um den Gestank zu überdecken (rechts). © rijksmuseum.nl Laut Schreiferius war der Wal nicht nur wegen seiner schrecklichen Größe ein Monster, sondern auch, weil er als Omen galt. Der Wortbedeutung nach ist ein Monster ein Bote, der Unheil ankündigt, denn das lateinische Wort „monstrum“ bedeutet sowohl „Monster“ im modernen Sinne als auch ein unheilvolles Zeichen. Wenige Tage nach seiner Ankunft bewahrheitete sich die Warnung des Wals: Am 24. Dezember 1601 ereignete sich eine Sonnenfinsternis. Neun Tage später folgte ein Erdbeben und am 4. Juni 1602 kam es zu einer weiteren Mondfinsternis. Diese ominösen Ereignisse spielen sich innerhalb der komplexen Grenzen des Gemäldes ab. Im Jahr 1618 wurde der Stich überarbeitet, um eine weitere Katastrophe darzustellen, die die Niederländische Republik nach der Ankunft des Wals heimgesucht hatte. Unterhalb der oberen Grenze taucht die Skelettfigur des Todes aus den Wolken auf, sein Pfeil schießt auf eine geflügelte Frau. Der aus drei Kreuzen gebildete Schild weist darauf hin, dass sie die „Jungfrau von Amsterdam“ ist (Anmerkung des Übersetzers: Der Schild mit den drei Andreaskreuzen darin ist noch heute im Amsterdamer Stadtwappen zu sehen). Während der Pest in den Jahren 1601–1602 herrschte in der Stadt Tod und das Gemälde lässt vermuten, dass die Ankunft des Pottwals dieses Ereignis vorhergesagt hat. Ausschnitt aus „Der gestrandete Wal von Beverwijk“, Jan Saenredamm, 1618. Eine spätere Version dieses Gemäldes von Saenredam fügt ein Skelett hinzu, das auf ein junges Mädchen aus Amsterdam schießt, ein Hinweis auf die Pest von 1601–1602. © rijksmuseum.nl Die Medizintheorie der frühen Neuzeit ging davon aus, dass Krankheiten durch den Geruch abgestandener, schmutziger Materie verbreitet würden. Zwischen 1667 und 1669 brach in der niederländischen Republik eine weitere Pest aus und bald darauf wurde das lateinische Werk des deutschen Universalgelehrten Athanasius Kircher über die Pest, Scrutinium Physico-Medicum Contagiosae Luis, Quae Pestis Dicitur (Eine körperliche und medizinische Untersuchung der ansteckenden Krankheit namens Pest), ins Niederländische übersetzt. Er berichtete, dass zu den Ursachen der Seuche Leichen, schlechte Luft und verwesende Wale gehörten, die an die Küste gespült wurden. In der zweiten Version des Gemäldes erhält das Taschentuch des Grafen eine neue, unheilvolle Bedeutung. Zwar hielt er das Taschentuch in der Hand, um den schrecklichen Verwesungsgeruch abzuwehren, doch er schützte sich damit auch vor dem virusverursachenden Gas. Das olfaktorische Paradoxon Während die Pest über Amsterdam hereinbricht, lauert tief im Magen eines in Beverwijk gestrandeten Wals ein olfaktorisches Paradoxon. Wenn unverdaute Tintenfischschnäbel den Darm des Pottwals reizen, entsteht eine ungewöhnlich duftende Substanz namens Ambra. Diese Substanz kann sich über Jahre ansammeln, bis der Pottwal sie ausscheidet oder bis es zu einem Darmdurchbruch kommt und sie sich schließlich aus dem Körper des Wals löst. Wenn die Substanz an die Oberfläche steigt, verändert sich ihr Geruch durch die Einwirkung von Salzwasser und Sonnenlicht vom abstoßenden Gestank von Fäkalien zum exquisiten, verführerischen Aroma von Ambra. Der graue Ambra kann jahrelang im Meer treiben, bevor er an Land gespült wird und perfekt an einem felsigen Strand versteckt ist. Im frühneuzeitlichen Europa war der Ursprung von Ambra ein Rätsel. Ambra war möglicherweise die Nahrung der Wale, manche glauben jedoch, dass es von Unterwasserinseln oder aus Bergschlamm stammt. Es könnte auch aus Bienenwaben stammen, die von Felsen am Meer fielen, oder aus dem aromatischen Kot ostindischer Vögel, von denen man glaubte, dass sie sich von duftenden Früchten und Insekten ernährten, was dem Ambra-Kot seinen angenehmen Geruch verlieh. Justus Fidus Klobius, ein Wissenschaftler aus Wittenberg, der die Vogeltheorie vertrat, stellte in seinem Buch über Ambra vier Seevögel dar, die auf einem Felsen stehen und von Insekten umgarnt werden. Ein kniender Mann sammelt Guano, während ein anderer Ambra-Sammler den Strand nach weiterem Dung absucht. In Clobius‘ Werk werden mindestens achtzehn Hypothesen zum Ursprung des Ambras aufgeführt, und über ein Jahrhundert lang konnte keine dieser Hypothesen bestätigt werden. In einer Schüssel wird der Kot eines ostindischen Vogels gesammelt, von dem man einst annahm, es handele sich um Ambra. Illustration aus Justus Fidus Clobius‘ Ambræ historiam (1666). © archive.org Der Entdecker des Ambra erlangte großen Reichtum. Georg Eberhard Rumphius, ein Botaniker der Niederländischen Ostindien-Kompanie (VOC), beschrieb in seinem naturgeschichtlichen Buch ein unglaublich großes Stück Ambra. Im Jahr 1693 kaufte das Amsterdamer Büro der Niederländischen Ostindien-Kompanie den fast 1,25 Meter hohen Stein vom König von Tidore auf den Molukken für einen geschätzten Preis von 116.400 niederländischen Gulden, was heute etwa 1,13 Millionen Euro entspricht. Die beigefügten Bilder erwähnen seinen starken Duft nicht, zeigen aber deutlich die raue, gewundene, marmorierte Oberflächenstruktur von Ambra. Abbildung von Ambra, das die Niederländische Ostindien-Kompanie aus Georg Eberhard Langfurs’ D'amboinsche rariteitkamer (1705) erworben hat. © Wellcome Collection Ambra wird oft wegen seines Duftes und Geschmacks gesucht. Es wurde über die Rühreier des englischen Königs Karl II. gestreut und verschönerte seinen Frühstückstisch bis zu seinem Tod im Jahr 1685, als das kräftige Aroma der Würzsoße das mutmaßliche Gift überdeckte, das seinen Tod verursacht haben soll. Eine halbe Unze fein gemahlener Ambra ist eine wesentliche Zutat des niederländischen Gerichts Amber-Podding, einem hedonistischen Eintopf aus Schmalz, Mandeln, Zucker, Weißbrot, Moschus (einem aromatischen Sekret des Moschushirsches) und Orangenblütenwasser, der in Schweinedärmen mit Ambra gekocht wird. Neben der Aromatisierung von Lebensmitteln wird die Substanz auch zum Imprägnieren von Lederprodukten verwendet, um den Geruch der übelriechenden Rückstände zu mildern, die beim Gerbprozess entstehen. In Sarnreddams Gemälde halten sich Touristen, die einen gestrandeten Pottwal in Beverwijk beobachten, mit Lederhandschuhen und Pelzmuffs warm, die möglicherweise mit Ambra parfümiert waren. Besucher, die vor dem gestrandeten Wal stehen, stehen Auge in Auge mit ihrem eigenen verwesenden Parfümeur. Besucher trugen Lederhandschuhe und Pelzmuffs, die oft mit Ambra parfümiert waren. Ausschnitt aus „Der gestrandete Wal von Beverwijk“, Jan Saenredamm, 1602. © rijksmuseum.nl Man glaubte, dass das reiche Aroma von Ambra Krankheiten abwehrt. Frühe medizinische Theorien gingen davon aus, dass übelriechende Substanzen Krankheiten hervorrufen könnten, während wohlriechende Substanzen den Körper schützen könnten. Ambra war Bestandteil von Räucherrezepten zum Ausräuchern von Häusern und wurde Süßwasserabkochungen zugesetzt, um den Körper von Pest zu befreien. Eines der faszinierendsten Objekte zur Seuchenprävention ist der Pomander, ein Duftanhänger. Der Name leitet sich vom lateinischen Wort für „Ambra-Apfel“ (pomum ambrae) ab, da der Hauptbestandteil der Parfümdose Pottwalparfüm ist. Diese luxuriöse silberne Parfümschachtel mit Fächern enthält sechs kleine Schachteln, in denen einst Salben mit unterschiedlichen Düften aufbewahrt wurden. Ambra wird oft mit Zimt, Rosmarin, Nelken und anderen Gewürzen gemischt. Einige Rezepte für Duftkästen verlangten nach Bernstein, einem versteinerten Harz, das sich zwar von Ambra unterschied, dessen Duft aber ebenfalls stark genug sein sollte, um Krankheiten abzuwehren. Für die Menschen der frühen Neuzeit war Ambra einer der klassischen Düfte zur Abwehr der Pest. Die verwesenden Leichen in Sarnreddams Gemälden offenbaren die Ursache der Probleme Amsterdams, doch paradoxerweise liegt die Lösung seiner Probleme tief in seinen Eingeweiden, wo sich der reiche Ambra verbirgt. Silberne holländische Räucherdose mit geschnitzten Vögeln auf Zweigen (ca. 1600–25). Alle Gewürzfächer sind zu öffnen. © rijksmuseum.nl Ölfarbe auf eine flache Oberfläche aufgetragen Jahrzehnte nachdem der gestrandete Wal das Schicksal Amsterdams vorhergesagt hatte, strömten Touristen in die Stadt in Rembrandts Atelier, um sein neuestes Werk zu sehen. Wie Rembrandts Biograf Arnold Houbraken feststellte, zog der Maler Besucher, wenn sie sich den Gemälden näherten, mit den Worten weg: „Vom Geruch der Gemälde wird einem schlecht.“ Ölfarbe wurde durch Mischen von Pigmentpulver mit Leinöl hergestellt, einem scharfen Bindemittel, das aus Leinsamen gepresst wurde. Wenn die beiden gemischt werden, entsteht ein extrem weiches, juwelenartiges Pigment, das feine Details und unterschiedliche Texturen ermöglicht. Bei Rembrandts Selbstporträts ging er nicht sparsam mit Ölfarbe um, sondern gestaltete das Bild regelrecht mit Ölfarbe. Für seine Nase trug er hautfarbene Farbe auf und um die Falten seines Hutes zu erzeugen, kratzte er Streifen blauer und gelber Farbe ab, um den schwarzen Hintergrund darunter freizulegen. Im Atelier muss der Geruch des Leinöls eine stark zerstörerische Wirkung gehabt haben, und Rembrandt nutzte ihn, um die Besucher dazu zu bewegen, sich von den Gemälden zu entfernen, um die groben, dicken Pinselstriche der Ölfarbe aus der besten Perspektive betrachten zu können. Das Gemälde hat viel von seinem Glanz behalten, aber der Duft ist mit der Zeit verblasst. Selbstporträt, Rembrandt, 1669. © www.mauritshuis.nl Rembrandts Hut wurde mit dicker Ölfarbe gemalt. Detail aus „Selbstporträt“, Rembrandt, 1669. © www.mauritshuis.nl Um den Geruch von Ölfarbe wirklich zu überwinden, dachte man, Künstler müssten Werke schaffen, die den Betrachter so fesseln, dass der scharfe Geruch im Atelier nicht mehr wahrnehmbar ist. Fast 20 Jahre bevor Houbraken über Rembrandts Atelier schrieb, bemerkte der Künstler und Kritiker Roger de Piles, dass ein schlechtes Gemälde „immer nach der Palette riecht“. Wenn es einem Kunstwerk nicht gelingt, die Vorstellungskraft des Betrachters vollständig zu fesseln, schleicht sich die Realität ein und das Gemälde entpuppt sich als das, was es wirklich ist: Farbe auf einer flachen Oberfläche. Aber vielleicht gibt es Ausnahmen von Depilers Diktum. Angesichts eines Stilllebens mit verrottendem Obst wird die Aufmerksamkeit des Betrachters möglicherweise nicht wieder ins Atelier gelenkt. Stattdessen wird ihre Fantasie durch den Geruch der schimmernden Farbe geweckt und der stechende Geruch des Verfalls wird realistisch. Aus den Gemälden ist ein intensiver Duft wahrnehmbar. Künstler haben die Niederländische Republik mit mikroskopischer Präzision zum Leben erweckt. Ob Landschaftsmalerei, grandiose Historienmalerei, Alltagsszenerie oder Porträtmalerei, überall sind Anspielungen auf Gerüche zu erkennen. Sie stiegen von kleinen Kohlenfeuern und brodelnden Töpfen auf, wurden auf humorvolle Weise aus dem Körper ausgeschieden und sickerten aus stagnierenden Substanzen. Zwischen den Gemälden sind verschiedene Utensilien zur Aufbewahrung von Weihrauch verstreut: Tonpfeifen, Schnupftabakdosen, Weihrauchdosen, Hüftketten, Bonbonbeutel, Muskatmühlen, Weihrauchbrenner, Teekannen, Medizingefäße, Fächer, Handschuhe und kunstvoll verzierter Weihrauchschmuck. In Sarnredams Gemälde sind es die verstreuten Eingeweide des Wals und das Taschentuch des Grafen, die den üblen Geruch andeuten. Durch die visuelle Aufzeichnung im Kunstwerk wird auch der Geruch dargestellt und die Fantasie des Betrachters angeregt. Knochen an einem Gebäude Das Ende der „Whale Watching Route“ befindet sich am Amsterdamer Rathaus. Pieter Jansz. Saenredam stellt diese Szene genau dar. Vor mehr als einem halben Jahrhundert wurde sein Vater Jan in Beverwijk Zeuge eines riesigen Wals. Obwohl das Rathaus mehrere Jahre zuvor niedergebrannt war (Rembrandt malte die schwelenden Ruinen), malte Sarnreddam die Szene aus der Erinnerung. Er verwendete einige seiner früheren Zeichnungen, um diesen Pastellstrukturen Details hinzuzufügen: überwuchertes Unkraut, bröckelndes Mauerwerk, im Wind schwankende Fensterläden und winzige Figuren, die durch die Straßen wandern und unter Arkaden ruhen. Über der linken Arkade des Vierschaars, des Hohen Gerichts, können wir eine dicke, bogenförmige Walrippe sehen, die mit Haken und Ketten zusammengebunden ist. Der Ursprung der Rippe ist unbekannt, aber sie war bereits an der Fassade befestigt, als Jan Saenredam 1601 den gestrandeten Pottwal sah. Lange bevor dieser Wal in Beverwijk an Land ging, hatten diese Monster bereits ihre Spuren in Amsterdam hinterlassen. Das Alte Rathaus von Amsterdam, Pieter Jans Saenredam, 1657. © rijksmuseum.nl Die Walrippe hing an Ketten über der Arkade des High Court. Detail des Alten Rathauses in Amsterdam, von Pieter Jans Saenredam, 1657. © rijksmuseum.nl Fischbeine wurden in öffentlichen Gebäuden oft an prominenter Stelle platziert. Im Jahr 1577 strandete eine Gruppe Pottwale und ihre Steiß- und Kieferknochen wurden als bleibendes Denkmal im Saal des Hohen Gerichtshofs der Niederlande in Den Haag aufgehängt. Als der Kaufmann Jan Huyghen van Linschoten 1596 von seiner Reise nach Nova Zembla zurückkehrte, schenkte er dem Rathaus von Haarlem einen Walkieferknochen, um diesen seltenen Schatz auszustellen und zu würdigen. Obwohl diese Wale nach einem langen Prozess ihr ursprüngliches Aussehen verlieren, können ihre Körper durch den verbleibenden Geruch ihrer inneren Organe erhalten bleiben. Im Jahr 1549 wurde in Livorno ein Wal an Land gebracht und sein Skelett nach Florenz transportiert und in der Loggia dei Lanzi ausgestellt. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Ausstellung abgebaut wurde: Das Mark in den Knochen war verrottet und verströmte einen unerträglichen Gestank. Im 17. Jahrhundert versuchten Walfänger, den Geruch zu mildern, indem sie Löcher in die Knochen bohrten, um Körperflüssigkeiten abzulassen, allerdings mit begrenztem Erfolg. Die Walrippe muss unsere Fantasie beflügelt haben und uns dazu gebracht haben, über das Tier nachzudenken, das Jona verschlang, über die Unermesslichkeit von Gottes Schöpfung zu staunen und an die pulsierenden Kreaturen zu denken, die die Walfänger in ihren nördlichen Kolonien auf Spitzbergen fingen. Es erinnert vielleicht auch an die Geschichte der Strandung an der niederländischen Küste. Wenn die Walknochen im Rathaus einen verwesenden Geruch verströmen – weil wir die Einzelheiten ihrer Herkunft nicht kennen –, dann genügt es, vor dem geistigen Auge des Betrachters den Wal in seinen Körper zurückkehren zu lassen und ihn in Gedanken zu dem Strand zurücktreiben zu lassen, an dem sein Körper verrottete. Von Lizzie Marx Übersetzt von Kushan Korrekturlesen/Rabbits leichte Schritte Originaltext/publicdomainreview.org/essay/picturing-scent Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von Kushan auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
>>: Sommerliche Gesundheitspflege, Feuchtigkeitsprävention und Milzschutz sind der Schlüssel
Artikel empfehlen
Wie man Tillandsia beschneidet: Schnittmethoden und Vorsichtsmaßnahmen
Tillandsia-Schnittzeit Zur Pflege der Eisenorchid...
Populärwissenschaftlicher Artikel | Welche Symptome treten bei Dysphagie im oralen Stadium auf? (Letzte Ausgabe)
Egal ob wir essen oder trinken, wir müssen schluc...
CB Insights: Spitzentechnologie erhielt im ersten Quartal 2016 Investitionen in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar
199IT Originalkompilation Im ersten Quartal 2016 ...
Ist Ding Ning Wang Jingmeng in der Schwertdynastie? Was ist Ding Nings wahre Identität?
„Sword Dynasty“ erfreut sich seit Beginn der Dreh...
Wie lagert und handhabt man frische Schwimmkrabben? So erkennen Sie, ob gefrorene Schwimmkrabben schlecht geworden sind
Die Schwimmkrabbe ist die wichtigste Meereskrabbe...
Welche Funktion hat der Verriegelungsknopf an der Autotür? Was bedeutet die Auto-Klimaanlage-Taste?
Viele Freunde kommen im Alltag oft mit neuen oder...
Wie wäre es mit der Genworth Financial Corporation? Genworth Financial Company Bewertungen und Website-Informationen
Was ist die Website der Genworth Financial Corpora...
Nährwert und essbare Vorteile von lila Trauben
Wenn Trauben reif sind, können sie viele verschie...
Wie man weißen Rettich einlegt
Weißer Rettich ist ein Gericht, das die Menschen ...
Pflanzzeit und -methode für Lauchwurzeln. Pflanzzeit und Vorsichtsmaßnahmen für Lauchwurzeln.
Pflanzzeit Die unterirdischen Wurzeln des Lauchs ...
Welchen medizinischen Wert hat die Selleriewurzel?
Jeder weiß, dass Sellerie ein Gemüse mit hohem es...
Beste Zeit zum Pflanzen von Wassermelonen (Saison) Wann ist die beste Zeit zum Pflanzen von Wassermelonen?
Pflanzzeit für Wassermelonen Wassermelonen werden...
Wie ist die Universität Delhi, Indien? Rezensionen und Website-Informationen zur Delhi University
Was ist die Website der Universität Delhi? Die Uni...
Welcher Boden eignet sich für den Anbau von Weißdornbäumen?
Einführung in den Weißdornbaum Weißdorn mag einen...