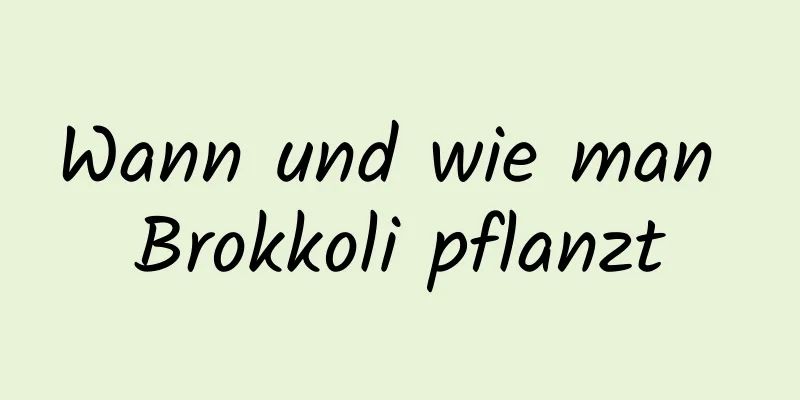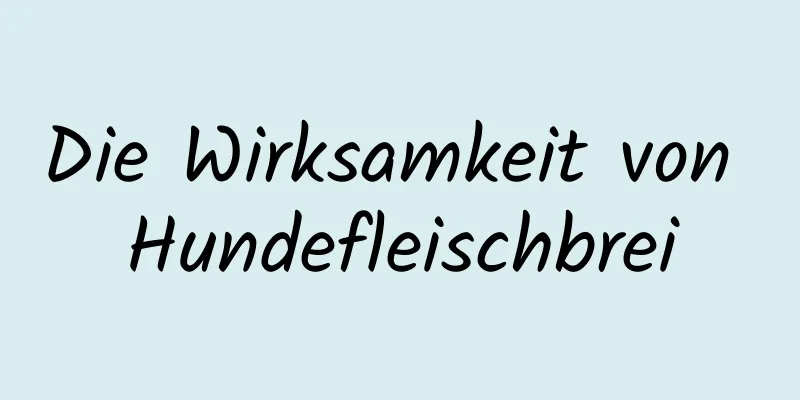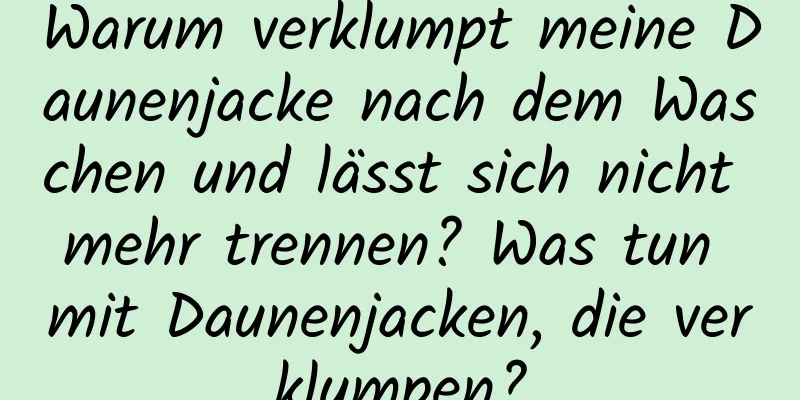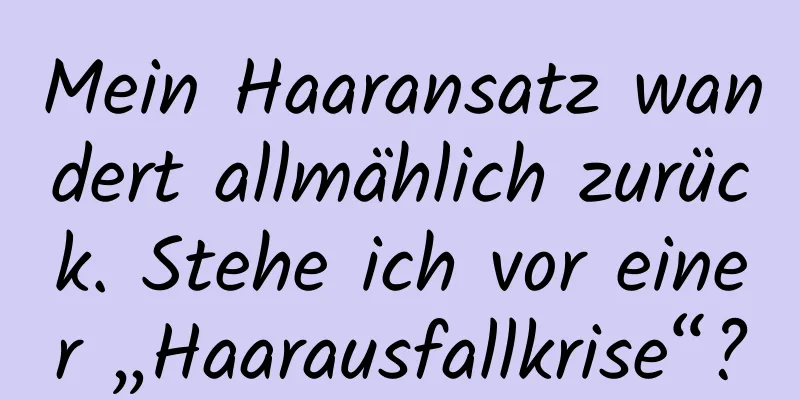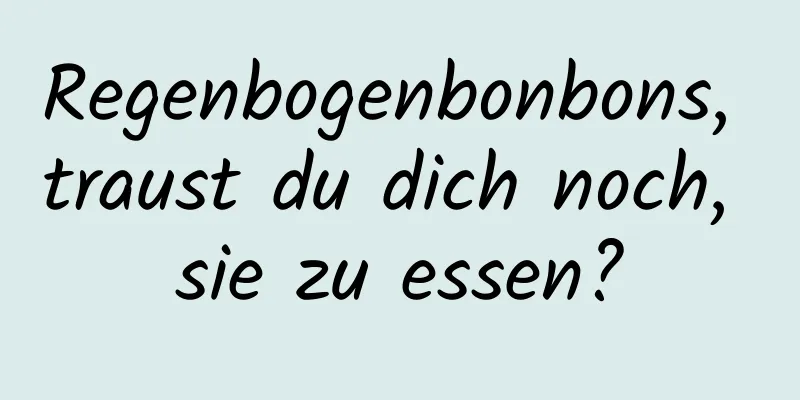Welche Veränderungen treten im Verlauf der Parkinson-Krankheit auf? Wie geht man damit um?

|
Autor: Wang Yichun, Peking Union Medical College Hospital Xu Dan, behandelnder Arzt am Peking Union Medical College Hospital Gutachter: Wang Han, Chefarzt, Peking Union Medical College Hospital Im Verlauf der Parkinson-Krankheit werden die Symptome des Patienten immer komplexer. Zusätzlich zum ursprünglichen Zittern, der Steifheit und den langsamen Bewegungen können motorische Komplikationen auftreten und die Reaktion auf Medikamente ist möglicherweise nicht mehr stabil. Darüber hinaus gehen im progredienten Stadium auch zahlreiche nicht-motorische Symptome einher, wie etwa Schlafstörungen, kognitive Beeinträchtigungen und Stimmungsschwankungen, die die Lebensqualität des Patienten zusätzlich beeinträchtigen. Das Erkennen und Beobachten von Zustandsveränderungen in diesem Stadium trägt nicht nur zur Entwicklung wirksamerer Behandlungspläne bei, sondern hilft den Patienten und ihren Familien auch dabei, mit den durch die Krankheit verursachten Problemen besser umzugehen. Abbildung 1 Copyright Bild, keine Erlaubnis zum Nachdruck 1. Symptomveränderungen im Verlauf der Parkinson-Krankheit Veränderungen der Symptome können viele Formen annehmen und mehrere Aspekte motorischer und nicht-motorischer Symptome umfassen. (1) Gliedmaßenüberlappung: bezieht sich auf die Zunahme der Anzahl der betroffenen Gliedmaßen und die Änderung der Symptomverteilung, wie z. B. Entwicklung von einer oberen Extremität zur unteren Extremität → zur gegenüberliegenden oberen Extremität → zur gegenüberliegenden unteren Extremität. (2) Veränderungen der Bewegungsform und des Bewegungsausmaßes: Beispielsweise kam es zunächst nur zu einem Zittern, später wird dasselbe Gliedmaß jedoch steif, die Amplitude des ursprünglichen Zitterns nimmt zu und es treten Gangstörungen wie Panik, Schleppen, Ausfallen und Erstarren auf. (3) Nächtliche Symptome: Tagsüber sind die Symptome des Patienten mild, doch nachts verschlechtert sich sein Schlaf erheblich, er hat Schwierigkeiten, sich umzudrehen, sein Zittern verschlimmert sich und er muss häufig auf die Toilette, was darauf hindeutet, dass die tagsüber eingenommenen kurzwirksamen Medikamente den Bedarf an langfristiger Symptomkontrolle nachts nicht mehr decken können. (4) Harn- und Darmerkrankungen: Beispielsweise erfordert Verstopfung, die früher durch Ernährungsumstellungen behandelt wurde, heute die häufige Einnahme von Abführmitteln. (5) Emotionale Wahrnehmung und psychische Symptome: Viele Patienten leiden vor dem Einsetzen der motorischen Symptome an einer Depression, die sich in den späteren Stadien allmählich verschlimmert. Darüber hinaus stellt der Rückgang der motorischen Fähigkeiten eine zusätzliche psychische Belastung für die Patienten dar und führt zu Gefühlsschwankungen. Kognitive Probleme können sich als Gedächtnisverlust äußern und in schweren Fällen kann es sein, dass der Patient den Weg nach Hause nicht findet. Halluzinationen können sich darin äußern, dass man nicht existierende Personen, Käfer oder Schlangen im Haus sieht und intensive Angstgefühle verspürt. (6) Schwindel: Besonders im Sommer kann es durch die Wirkung von Medikamenten und die Krankheit selbst leicht zu einem Blutdruckabfall kommen. Sogar Patienten mit Bluthochdruck können ohne Medikamente einen normalen oder niedrigen Blutdruck haben. Daher muss die Überwachung verstärkt werden. (7) Müdigkeit: Wenn Sie sich schwach fühlen und sich trotz ausreichendem Schlaf nicht erholen können, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Krankheit fortschreitet oder die Medikamente nicht ausreichend wirken. (8) Schmerzen: Es kann sich auch um ein Wundheits- und Taubheitsgefühl handeln, das auf das Restless-Legs-Syndrom hinweisen oder mit einer gleichzeitig bestehenden Osteoarthritis oder peripheren Neuropathie zusammenhängen kann. (9) Sprechen und Schlucken: Zu den Symptomen zählen langsameres Sprechen, tiefere Stimme, Stottern, langsames Essen und Würgen. Manchmal schlingt der Patient einen Bissen Essen hinunter, weiß aber nicht, wie er es schlucken soll. II. Veränderungen der Arzneimittelwirksamkeit im Verlauf der Parkinson-Krankheit Änderungen im Zusammenhang mit der Wirksamkeit von Arzneimitteln können in die folgenden Kategorien unterteilt werden. (1) End-of-Dose-Phänomen oder End-of-Dose-Fluktuation: Frühe Patienten nehmen das Arzneimittel normalerweise dreimal täglich ein und die Dosierung ist relativ gering. Sie haben das Gefühl, dass es wirksam ist und sich im Tagesverlauf kaum etwas ändert. Im weiteren Krankheitsverlauf kommt es jedoch häufig zu einer Verschlechterung der Symptome gegen Ende der letzten Dosis und etwa eine Stunde vor der nächsten Dosis. Dies wird als „End-of-Dose-Phänomen“ bezeichnet (wenn Sie beispielsweise um 7 Uhr und 12 Uhr mittags eine Dosis einnehmen, verschlechtern sich die Symptome wahrscheinlich zwischen 11 und 12 Uhr) und bessern sich nach der nächsten Dosis wieder. Dies ist eine vorhersehbare Symptomschwankung. (2) Switching-Phänomen: Auch hier kommt es zu unvorhersehbaren Schwankungen der Symptome. Der Patient ist plötzlich nicht mehr in der Lage, sich im Alltag zu bewegen, wird dann aber nach einigen Minuten oder mehr als 10 Minuten wie durch einen Ein-/Ausschalter von selbst wieder gesund. Daher spricht man auch vom „Umschaltphänomen“. (3) Abnorme Bewegungen: Zu den leichten Symptomen gehört Zittern, während zu den schweren Symptomen Ruhelosigkeit, Unfähigkeit aufzustehen und Verdrehen im Liegen gehören, manchmal begleitet von Schmerzen. Es besteht kein Grund zur Sorge oder Angst vor dieser Situation. Solange die Lebensqualität nicht wesentlich beeinträchtigt wird, ist keine besondere Behandlung erforderlich. In schweren Fällen kann die Medikation entsprechend angepasst werden. (4) Dystonie: Sie äußert sich in einer abnormalen Körperhaltung, beispielsweise in einer Krümmung der großen Zehe oder in einem Graben im Boden, manchmal begleitet von Schmerzen, die oft morgens auftreten. (5) Verzögerter oder fehlender Wirkungseintritt nach Einnahme des Medikaments: Die Wirkung des Medikaments ist deutlich reduziert, was ein sehr klares Signal dafür ist, dass der Patient das Stadium der Progression erreicht hat. Einige Studien gehen davon aus, dass es ein Anzeichen dafür ist, dass die Krankheit in das fortgeschrittene Stadium eingetreten ist, wenn der Patient tagsüber länger als zwei Stunden wach ist oder wenn er länger als eine Stunde starke Schmerzen in seinen Bewegungen hat. 3. Was können Patienten mit fortschreitender Parkinson-Krankheit in Zusammenarbeit mit Ärzten tun? Abbildung 2 Copyright Bild, keine Erlaubnis zum Nachdruck Das Wichtigste ist zunächst einmal, dass die Patienten selbst und ihre Betreuer etwas lernen. So können beispielsweise die oben genannten Inhalte mehrfach wiederholt werden. Wenn sie diese beherrschen, können sie Gewohnheiten zur täglichen Beobachtung entwickeln und wissen, auf welche Situationen geachtet werden muss und welche dem Arzt mitgeteilt werden müssen. Es wird empfohlen, einige Aufzeichnungsmethoden anzuwenden: beispielsweise das Führen eines Tagebuchs, um die Zeit, den Medikamentenstatus und nachfolgende Reaktionen aufzuzeichnen; oder Aufnahme mit einem Mobiltelefon. Das intuitive Video eignet sich besonders zur Erfassung des Bewegungszustandes. So können Ärzte beispielsweise feststellen, ob sich der Tremor verschlimmert oder anormal ist, wie der Gangzustand ist usw. Darüber hinaus wird die Entwicklung neuer intelligenter Programme und tragbarer Geräte bei der Medikamentenverwaltung und Videoaufzeichnung helfen und es den Patienten ermöglichen, sich am Krankheitsmanagement zu beteiligen. Zweitens ist auch eine regelmäßige Nachsorge sehr wichtig. Im Allgemeinen wird empfohlen, während der Progressionsphase alle 3 bis 6 Monate eine Nachuntersuchung durchzuführen. Während des Nachsorgeprozesses verwenden wir einige Skalen, beispielsweise die UPDRS-Skala, um den Schweregrad der Erkrankung einzuschätzen und die dynamischen Veränderungen im Zustand des Patienten objektiv widerzuspiegeln. Viele dieser Skalen können selbst eingeschätzt oder mit Unterstützung von Familienmitgliedern ausgewertet werden. Lassen Sie uns abschließend den obigen Inhalt mithilfe einer Mindmap zusammenfassen. Die Symptomschwankungen im progressiven Stadium umfassen sowohl motorische als auch nicht-motorische Symptome. Die beiden wichtigsten Phänomene – Schluckbeschwerden, Atembeschwerden und Lungenentzündung durch Ersticken sowie Stürze, Knochenbrüche und Bettruhe infolge von Gang- und Gleichgewichtsstörungen – können zu einer plötzlichen Verschlechterung der Krankheit führen und erfordern besondere Aufmerksamkeit. Der Zwischenzustand, in dem sich die Symptome des Patienten von der stabilen Phase (Flitterwochenphase) zur fortschreitenden Phase ändern, wird als instabile Phase bezeichnet. Eine frühzeitige Erkennung und Behandlung dieser Phase kann dazu beitragen, das Auftreten unerwünschter Sportereignisse zu verhindern. Abbildung 3 Verlauf der Parkinson-Krankheit und Beobachtungsmethoden Quellen: [1] KALIA LV, LANG DAE Parkinson-Krankheit[J]. Lancet, 2015, 386(9996):896-912. [2]TITOVA, NATALIYA, CHAUDHURI, et al. Nicht-motorische Parkinson-Krankheit: neue Konzepte und personalisiertes Management[J]. Medical Journal of Australia Zeitschrift der australischen Ärztevereinigung, 2018. |
<<: Darmdetektiv: Entdecken Sie die Gesundheitsgeheimnisse Ihres Stuhls
>>: Teewissenschaft | Tipps: Kann Teetrinken beim Fettabbau und Abnehmen helfen?
Artikel empfehlen
Wie man Lilien-Mandel-Porridge macht
Im Folgenden stelle ich Ihnen die Zubereitung von...
Warum schwellen die Augenlider an? Wie man Augenödeme loswird
Viele Menschen stellen beim Aufwachen am nächsten...
Wie züchtet man den Glücksbaum? Anbautechniken des Glücksbaums
Der Glücksbaum ist ein grüner Baum, der Glück und...
Warum ist es für Menschen mit hohem Blutdruck nicht ratsam, über längere Zeit Zwiebelrotwein zu trinken? Wie lange sind in Rotwein eingelegte Zwiebeln haltbar?
Theoretisch kann das Einlegen von Zwiebeln in Rot...
Ist es giftig, wenn Teebaumpilze nicht blanchiert werden? Wie man Teebaumpilze einweicht, um sie weich zu machen
Der Teebaumpilz ist ein essbarer Pilz, der haupts...
Wie wäre es mit BHP? BHP-Bewertungen und Website-Informationen
Was ist BHP Billiton? <div 必和必拓公司(BHP Billiton)...
Was ist mit dem ungarischen Ministerium für Bildung und Kultur? Rezensionen und Website-Informationen des ungarischen Ministeriums für Bildung und Kultur
Wie lautet die Website des ungarischen Ministerium...
Die Gefahren und Pflegemaßnahmen bei schwangerschaftsbedingter Hypertonie
Präeklampsie ist eine häufige und schwerwiegende ...
Wann ist die beste Pflanzzeit für Sellerie? Wie und wann man Sellerie pflanzt
Sellerie ist unter den Blattgemüsen das am weites...
Wie viele Tage dauert es, bis Süßkartoffeln geerntet werden können?
Süßkartoffeln werden grob in vier Wachstumsstadie...
Mag Tigerpiranha die Sonne?
Tigerpiranha mag die Sonne Die Tigerhaut-Orchidee...
Zutaten und Schritte zur Zubereitung einer Mungobohnen- und roten Bohnensuppe
Die Kombination aus Grün und Rot erzeugt einen st...
Wie hält man Messer und Gabel beim Verzehr westlicher Speisen?
In China gibt es mittlerweile immer mehr westlich...
Wie isst man Zuckerapfel? Tipps zum Verzehr von Zuckerapfel
Zuckerapfel ist eine Spezialfrucht, die in tropis...
Wie wäre es mit der Nationalbank von Kanada? Bewertungen und Website-Informationen der National Bank of Canada
Was ist die Website der National Bank of Canada? D...