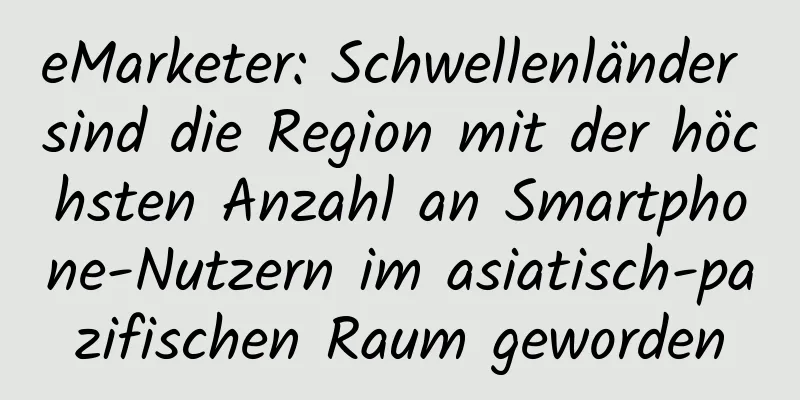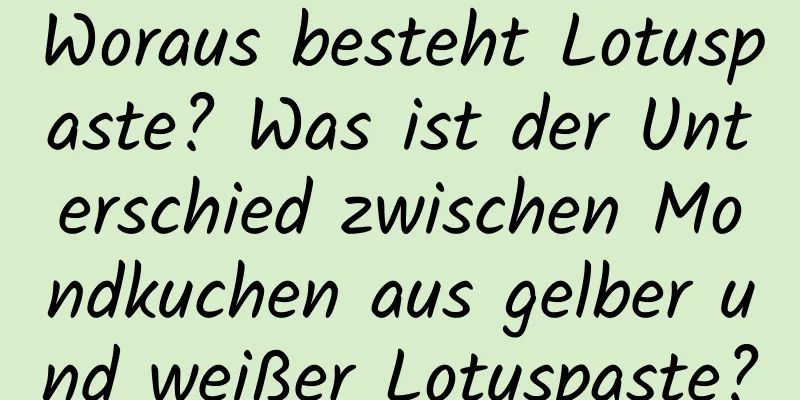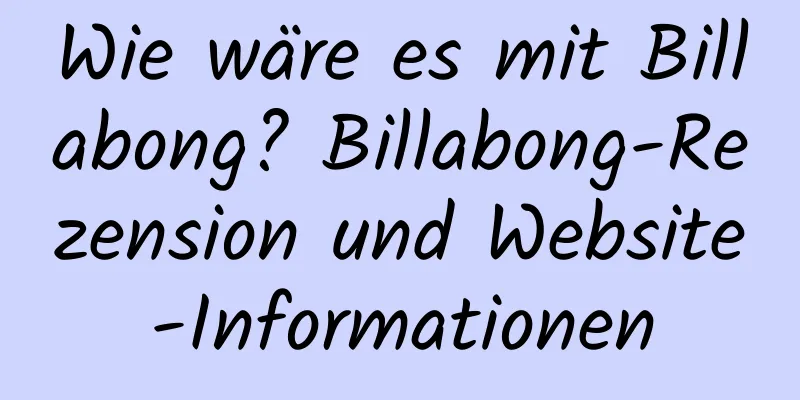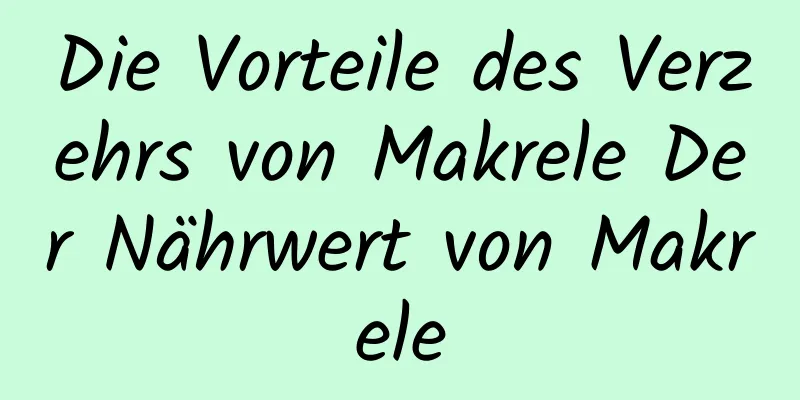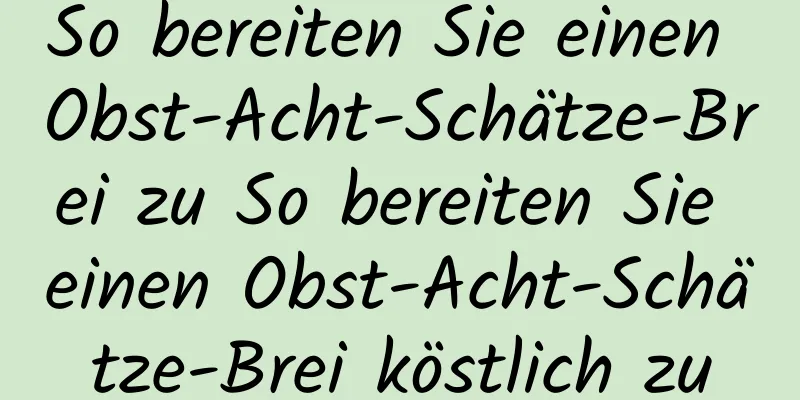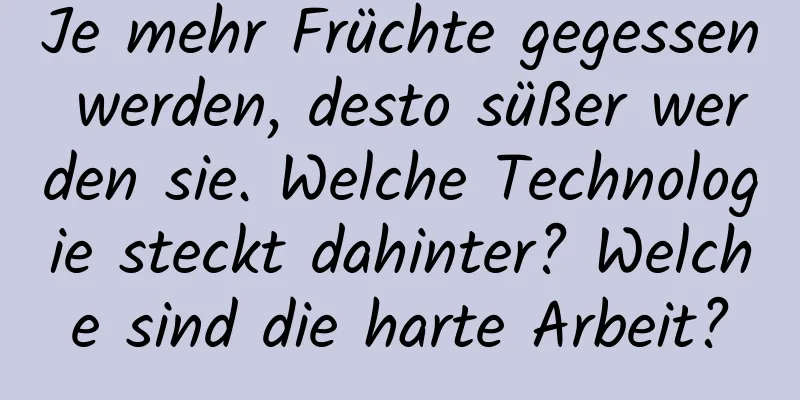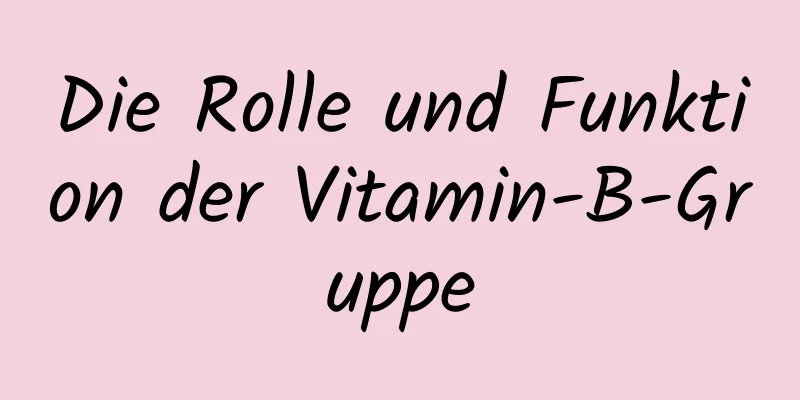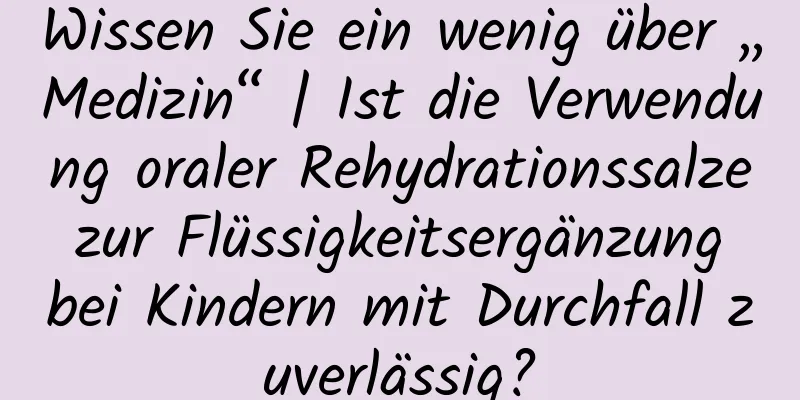Ohnmacht und moralisches Dilemma
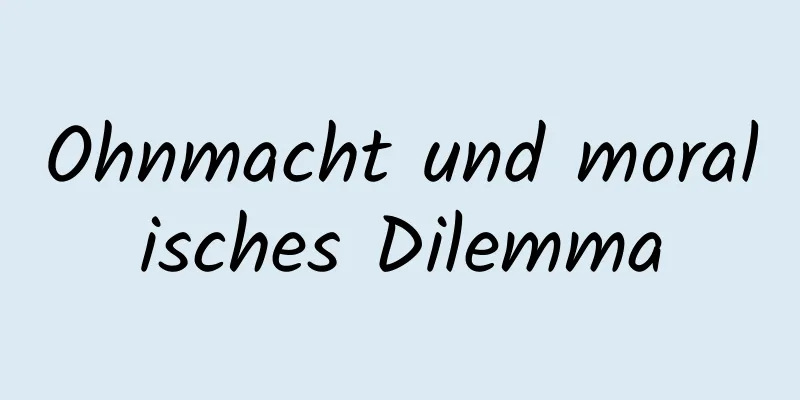
|
Leviathan Press: Es gab zwei Seeleute, A und B, die Schiffbruch erlitten. Gleichzeitig sahen beide ein Stück Brett, das nur eine Person tragen konnte, und versuchten, darauf zuzuschwimmen. A schwamm zuerst zum Brett und kletterte darauf. Als B ankam, stieß er A vom Deck und ermöglichte sich selbst, der im Begriff war zu ertrinken, auf das Deck zu klettern. Am Ende ertrank A und B wurde vom Such- und Rettungsteam gerettet. Sollte B wegen Mordes angeklagt werden? Das Obige ist ein Gedankenexperiment des antiken griechischen Gelehrten Karneades. Es gibt viele Beispiele für moralische Dilemmata dieser Art, wie etwa den berühmten Fall „Queen v. Dudley & Stephens“, bei dem ein Besatzungsmitglied kannibalisiert wurde, um zu überleben, der im anglo-amerikanischen Rechtssystem sehr bekannt ist. Folgt moralisches Verhalten aus formalen Überlegungen? Sozialintuitionisten würden das wahrscheinlich nicht denken – in vielen Fällen neigen Menschen dazu, moralische Urteile zu fällen, ohne sich um Gerechtigkeit, Gesetze, Menschenrechte und abstrakte ethische Werte zu kümmern. Auf jeden Fall stehen wir oft vor solchen ethischen Dilemmas. Die Frage, wie man zu einer grundlegenden psychologischen Konstruktion und einem Denkrahmen kommt, sollte sich jeder stellen. „Schau nicht auf das Unangebrachte, höre nicht auf das Unangebrachte und sprich nicht über das Unangebrachte“ ist ein altes Sprichwort (in der östlichen Zivilisation). Die Inspiration hierfür stammt von der japanischen Skulptur „Drei Affen“: drei Affen, einer mit verbundenen Augen, einer mit den Ohren und einer mit dem Mund. (Anmerkung des Übersetzers: Dieser Satz aus den Analekten des Konfuzius – Yan Yuan wurde etwa im 8. Jahrhundert in Japan eingeführt und bildete die Kultur der „Drei Affen“ mit japanischen Merkmalen.) Im Westen wird dieser Satz oft verwendet, um Menschen zu lehren, sich keine Dinge anzusehen, die gegen das Gesetz und die Moral verstoßen, aber seine ursprüngliche Bedeutung besteht darin, dass Menschen immer böse Gedanken aufgeben sollten und dasselbe für ihre Handlungen gilt. Aber was sollen wir tun, wenn wir feststellen, dass es keinen Ort gibt, an dem wir uns vor dem „Bösen“ verstecken können? Was tun wir, wenn wir es sehen, hören oder nicht in der Lage sind, es loszuwerden? Was wäre, wenn unsere Entscheidung, unsere Stimme zu erheben oder dem Bösen entgegenzutreten, eine direkte Bedrohung für uns selbst oder die Menschen und Dinge darstellt, die wir lieben? Was sollen wir tun, wenn das Leben uns zwingt, zwischen zwei „Fehlern“ oder Dilemmata zu wählen, und jede der beiden Entscheidungen einen Verrat an den Grundwerten, Verpflichtungen und Zusagen darstellt, an die wir fest glauben? Wie treffen wir diese sogenannten „Entscheidungen“? Oder noch weiter gehend: Wie können wir mit diesen „Fehlern“ koexistieren? Sind das Verbrechen, die wir selbst begangen haben, oder wurden sie von anderen für uns inszeniert? Das Konzept des „moralischen Dilemmas“ Im Jahr 1984 schlug der Philosoph Andrew Jameton erstmals das Konzept des „moralischen Dilemmas“ vor. Damit wird die Situation beschrieben, in der Pflegekräfte aufgrund institutioneller und systembedingter Einschränkungen nicht in der Lage sind, das zu tun, was sie für richtig halten, insbesondere wenn es um grundlegende moralische Standards und ethische Verantwortlichkeiten geht. In einer Welt, die von der COVID-19-Pandemie erfasst wird, setzen die ethischen Dilemmata die heutigen Mitarbeiter des Gesundheitswesens und diejenigen, die die Hauptlast der Ereignisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit tragen, einem beispiellosen Druck aus. Aber sie sind nicht allein. Im Jahr 2020 stellt die Epidemie eine ernste Bedrohung für die globale Gesundheit dar und hat die soziale, politische und wirtschaftliche Lage stark erschüttert. Viele Menschen sahen sich daher mit schwierigen Momenten moralischer Dilemmata konfrontiert. Manchmal kann das, was zuvor als ethisches Verhalten galt, von dem abweichen, was eine Person instinktiv wählen und tun würde, wenn es andere Möglichkeiten gäbe. Beispiele hierfür sind: Eltern stehen vor dem Dilemma, ihre Kinder zur Schule zu schicken oder sie zu Hause zu unterrichten. Die persönlichen Werte und Überzeugungen der Amerikaner stehen im Konflikt mit den staatlichen und nationalen Sicherheitsvorschriften (oder dem Fehlen derselben). Kleine Unternehmen mussten schließen, um Verluste zu begrenzen, obwohl sie ihren Mitarbeitern und deren Familien gegenüber eine Treuepflicht haben. Familien brauchen eine sichere Unterkunft, können sich diese aber aufgrund von Arbeitslosigkeit oder anderen Eigentumsproblemen nicht leisten und mussten ihre Häuser verkaufen, um über die Runden zu kommen. Natürlich möchten die Menschen mehr Zeit mit älteren Menschen und mit allein lebenden oder schwer erkrankten Verwandten und Freunden verbringen, doch aufgrund der Quarantänebestimmungen ist dies nicht möglich. Wir sind gefangen in sozialer und kultureller Ungleichheit und Ungerechtigkeit, haben aber gleichzeitig das vage Gefühl, dass sich daran auch in Zukunft nichts ändern wird. Unser anerkanntes „Bürgertum“ und unser „bürgerliches Verhalten“ haben strukturelle Veränderungen erfahren, aber wir haben diese Werte auf individueller und kollektiver Ebene nicht respektiert. Die „andere Seite“, die uns in sozialen und politischen Fragen gegenübersteht, hat eine Offensive auf Leben und Tod gestartet, und wir sind machtlos, etwas dagegen zu unternehmen. Wenn wir uns in einem moralischen Dilemma befinden, haben wir oft das Gefühl, dass wir keine Möglichkeit haben, unseren Kummer auszudrücken, dass wir eingeschränkt, nicht wertgeschätzt, nicht angehört oder nicht verstanden werden. Wir lassen uns leicht von Gefühlen wie Wut, Ekel, Angst und Frustration kontrollieren. Allmählich erfüllen solche Emotionen unser Leben mit Angst, Müdigkeit und Verzweiflung. Ein Gefühl der Verwüstung macht sich breit und lässt uns mit einer Frage zurück: Wer sind wir und was ist die Welt? Untersuchungen zeigen auch, dass moralische Belastungen dauerhafte Auswirkungen haben, wie etwa Burnout, Erschöpfung, Gefühllosigkeit, Trennung und verminderte moralische Sensibilität (auch bekannt als „Mitgefühlsermüdung“). (journals.lww.com/ajnonline/Fulltext/2017/02001/Cultivating_Moral_Resilience.3.aspx)(journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0969733019889400) Ärzte sind nicht die einzigen, die im Gesundheits- oder Sozialwesen mit moralischen Dilemmata zu kämpfen haben. Auch Veränderungen im Verhalten oder in der Pflegeeinstellung des Gesundheitspersonals können negative Auswirkungen auf die Patienten haben. Im Alltag können derartige Verkalkungen die zwischenmenschliche Beziehung und die Arzt-Patienten-Beziehung erheblich schädigen. In extremen Formen kann es sogar zu einer „Normalisierung“ kommen. Machtlosigkeit ist der Kern moralischer Dilemmata. Dieses Gefühl entsteht, dass wir aufgrund äußerer Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, passiv oder aktiv Kompromisse eingehen oder Dinge aufgeben müssen, die uns lieb und teuer sind. Wie moralische Dilemmata uns begleiten Tatsächlich sind Menschen nicht besonders gut darin, Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren. Ebenso wie physische Bedrohungen können auch psychische und existentielle Bedrohungen oder „seelische“ Bedrohungen (wie etwa Bedrohungen unserer Integrität) das menschliche Nervensystem aktivieren und es von einem ruhigen, kontrollierten Zustand in den Überlebensmodus versetzen. Der primitivste Teil des Gehirns, das Reptiliengehirn, ist immer in höchster Alarmbereitschaft und sucht ständig in der Umgebung nach weiteren potenziellen Bedrohungen, und der Körper ist immer bereit zu reagieren. (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4406946/) Wenn dies geschieht, wird eine Flut von Stresschemikalien freigesetzt, die zu körperlichen, emotionalen und kognitiven Veränderungen führen. Unsere Herzfrequenz und unser Blutdruck steigen und unsere Muskeln spannen sich an. Alle nicht benötigten Funktionen werden deaktiviert. Negative Emotionen werden aktiviert. Gefühle oder Bedürfnisse angemessen auszudrücken und zu vermitteln, kann schmerzhaft und anstrengend sein. Unsere Aufmerksamkeit nimmt ab und richtet sich zunehmend auf potenzielle Bedrohungen. Unsere Empathie lässt nach, beeinträchtigt unser prosoziales Verhalten und verstärkt unsere Abhängigkeit von instinktiven, defensiven Denk- und Verhaltensmustern. (www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/prosocial-behavior) Normalerweise ergreifen wir spontane Maßnahmen, um mit diesem Stress umzugehen und ihn zu bewältigen. Dabei gibt es drei Möglichkeiten: kämpfen (versuchen, die Kontrolle wiederzuerlangen, indem wir die Quelle der Bedrohung neutralisieren oder größere Macht demonstrieren); Flucht (Ausstieg aus der Situation durch Aufgeben oder Milderung des Konflikts in einem moralischen Dilemma); und Erstarren (Untätigkeit oder Lähmung; uns selbst betäuben, indem wir „es durchstehen“; und Ablenkung, Verleugnung oder völlige Loslösung von der Ursache des Dilemmas). Das wiederholte Erleben ethischer Dilemmata ohne jemals einzugreifen, führt zu einem Zustand anhaltender Disharmonie, der sich in einem ganz bestimmten Sinne insbesondere in unseren Organisationen ansammelt. Mit anderen Worten: Auch wenn eine Krise vorüber ist, hinterlässt sie einen „moralischen Rückstand“ oder „moralischen Fleck“ (auch „schleichender Effekt“ genannt), der in unserem Leben fortbesteht. Wie eine verstopfte Arterie kann diese moralische Blockade unser Leben bedrohen. Moralische Belastbarkeit entwickeln Resilienz wird im Allgemeinen als die Fähigkeit definiert, sich von Stress, Widrigkeiten und Traumata zu erholen oder sich anzupassen. Dadurch können diese Veränderungen und Herausforderungen unser Leben bereichern, anstatt es zu schädigen, und unseren Geist stärken, statt ihn zu schwächen. Diese Widerstandsfähigkeit lässt uns erkennen, dass wir nach Schwierigkeiten nicht unbedingt am ganzen Körper Wunden davontragen. Herausforderungen sind nur vorübergehend. Obwohl moralische Resilienz noch ein junges Konzept ist, ist sie mit psychologischer Resilienz verwandt, die beiden unterscheiden sich jedoch in dreierlei Hinsicht. Cynda Hylton Rushton, eine führende Persönlichkeit auf dem Gebiet der klinischen Ethik und Professorin für Krankenpflege und Pädiatrie an der School of Nursing der Johns Hopkins University, glaubt, dass „moralische Resilienz sich mit den moralischen Aspekten der menschlichen Erfahrung, der moralischen Komplexität von Entscheidungen, Verpflichtungen und Beziehungen sowie den unvermeidlichen moralischen Herausforderungen befasst, die Gewissenskonflikte, Verwirrung und moralische Dilemmata auslösen.“ Da der moralische Bereich so eng mit allen Aspekten der menschlichen Natur (biologisch, psychologisch, kognitiv, spirituell und relational) verbunden ist, kann die Entwicklung moralischer Belastbarkeit uns als ganze Person sowie auf vielen spezifischen Ebenen zugute kommen. Das Jahr 2021 präsentiert sich uns weiterhin als Herausforderung. Wenn auch Sie das Gefühl haben, in einem moralischen Dilemma zu stecken und verzweifelt an Ihrer eigenen Beständigkeit festhalten möchten, können Ihnen die folgenden Methoden dabei helfen, moralische Belastbarkeit zu entwickeln. Autonomie: Die Kunst des Selbstmanagements erlernen Autonomie ist die auf die Gegenwart ausgerichtete Erkenntnis, dass wir zwar akzeptieren, dass wir möglicherweise nicht alle Umstände oder Ergebnisse kontrollieren können, aber immer die Kontrolle über unseren eigenen Körper, Geist und unsere Seele behalten können. Dabei geht es darum, zu lernen, auch in schwierigen Situationen eine anmutige Haltung beizubehalten. Erstens können wir unsere Aufmerksamkeit nach innen richten oder unsere innere Wahrnehmung trainieren. Innere Achtsamkeit hilft uns, die tieferen Schichten des Bewusstseins unter der Oberfläche zu erkennen, die möglicherweise zu unseren Gefühlen, Gedanken und Handlungen beitragen. Versuchen Sie bei Ihrer inneren Selbsterforschung nicht, unangenehme Emotionen zu beseitigen oder sie als Fehler oder Schwächen zu werten. Wir geben diesen Emotionen Raum, uns mitzuteilen, was für neue Dinge passieren, von denen wir nichts wissen. Wir beobachten und fragen uns, welche moralischen Werte, Verpflichtungen oder Verantwortlichkeiten nicht erfüllt werden, wie diese Emotionen unsere Beziehung zur misslichen Lage beschreiben und ob es für uns andere Möglichkeiten gibt, diese Werte zu verwirklichen. Auf diese Weise können wir den inneren Frieden und die Perspektive wiedererlangen, die für die Aufrechterhaltung unseres „Toleranzfensters“ so wichtig und der Schlüssel zur Autonomie sind. Auf diese Weise können wir uns immer, egal wie schwierig es ist, bewusst dafür entscheiden, unsere Grundwerte auszuleben, prinzipielle Entscheidungen zu treffen und kluge, ethische Maßnahmen zu ergreifen. Zwei Möglichkeiten, diesen inneren Raum zu erkunden, sind Achtsamkeitsübungen und Titration. Selbsterkenntnis: „Sich selbst treu bleiben“ Rushton glaubt, dass moralische Belastbarkeit auf einem Gefühl moralischer Verantwortung beruht. „Wenn wir uns in einer Situation befinden, die der moralischen Gerechtigkeit widerspricht, kann uns das Gefühl moralischer Verantwortung ständig daran erinnern, wer wir sind und woran wir glauben.“ Diese Wachsamkeit oder dieser Wunsch nach Moral erfordert, dass wir uns grundsätzlich darüber im Klaren sind, welche Werte, Verantwortlichkeiten und Missionen wirklich unseren moralischen Kern ausmachen. Dies bedeutet, dass wir uns ständig selbst reflektieren müssen, sonst laufen wir Gefahr, selbstgefällig zu werden und unsere moralische Sensibilität zu verlieren. Gleichzeitig scheuen wir uns davor, dogmatisch und willkürlich zu werden. Selbsterkenntnis ist ein Tanz bewusster Erfahrung, der von uns verlangt, demütig, vorsichtig und mutig unsere eigenen Gefühle, Gedanken und Wünsche zu erforschen. Ich möchte diese Haltung „mitfühlende Aufrichtigkeit“ nennen. Wir müssen außerdem klar und transparent sein, das heißt, wir müssen bereit sein, zuzugeben, wenn unsere Überzeugungen voreingenommen, verzerrt, kurzsichtig oder falsch sind. Gleichzeitig müssen wir für mögliche Änderungen, Korrekturen oder unerwartete Ergebnisse offen sein. Die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis gibt uns die Möglichkeit, den Kopf hochzuhalten, die Augen offen zu halten, die Schultern zu entspannen und unseren Glauben festzuhalten und Möglichkeiten zu finden, mit moralischen Dilemmata mit minimalem persönlichen Aufwand umzugehen. Selbstdarstellung: Entscheidungen treffen und Beiträge mit moralischer Reinheit und Kompetenz leisten Es gibt viele Möglichkeiten, sich auszudrücken, aber wenn es um moralische Belastbarkeit geht, sind zwei Methoden besonders wirksam: die Entwicklung moralischer Kompetenz und eine klare und selbstbewusste Ausdrucksweise. Moralische Kompetenz beinhaltet das, was Rushton als moralische Verkörperung bezeichnet, also unseren Wunsch, sicherzustellen, dass sich die Wahrheiten und Überzeugungen, die wir vertreten, in unseren Handlungen widerspiegeln und dadurch zeigen, dass wir die Werte, die wir vertreten, auch ausleben. Wir entwickeln und kultivieren ein moralisches Vokabular, Vorstellungskraft, Einstellungen, einen stimmigen Charakter und eine lebendige moralische Haltung, tauchen in eine „moralische“ Welt ein und sind dabei geduldig, offen und tolerant gegenüber den Werten, Bedürfnissen, Hoffnungen und Ängsten anderer. Klar und selbstbewusst zu sprechen bedeutet, unsere Sorgen auszudrücken, indem wir unsere Probleme und Zweifel nutzen, um bei anderen Anklang zu finden, die sich in der gleichen Situation befinden. Anstatt das moralische Dilemma als eigenständiges Ergebnis zu betrachten, ist es besser, es als Beginn einer umfassenderen, substanzielleren Diskussion über die Dynamik der Situation zu betrachten. Zu einem klaren und selbstbewussten Ausdruck gehört auch, dass wir wissen, wann wir uns – vorübergehend oder dauerhaft – aus einer Situation, einem System oder einer Beziehung zurückziehen müssen, die unser moralisches Empfinden möglicherweise irreparabel beschädigt hat. Sinn schaffen: Nicht Sinn fordern, sondern Sinn schaffen Sinnstiftung ist der Prozess des Wahrnehmens, Erkennens und Verstehens in unserem Umgang mit dem Leben, unseren Beziehungen und uns selbst. Es bietet uns eine Möglichkeit, unsere Erinnerungen zu ordnen und unsere Erfahrungen zu gestalten. Sinnhaftigkeit hilft auch dabei, Widersprüche in unseren Werten, Überzeugungen und Erwartungen sowie in unserer Einstellung zum Leben zu überwinden. Dies ist insbesondere in Zeiten moralischer Not wichtig. Sinnloses Leiden ist ein wichtiger Aspekt der moralischen Belastbarkeit. Wir sagen uns oft: „Warum sollte ich es weiter tun, wenn sich nichts ändern kann?“ oder „Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um mich zu ändern, aber es ist nie genug.“ Oder: „Ich kämpfe gegen ein kaputtes System, das von Natur aus fehlerhaft ist.“ Diese Gefühle der Unzufriedenheit können sehr negative und hoffnungslose Erfahrungen auslösen oder den Grundstein für weiteres prinzipielles Handeln legen. Eine Möglichkeit, Sinn zu schaffen, besteht darin, Situationen noch einmal zu überdenken, die vielleicht nicht offensichtlich waren oder die Sie zuvor möglicherweise abgetan haben. Denken Sie darüber nach: Haben Sie schon einmal Informationen übersehen oder falsch verstanden? Verbirgt Ihre Unzufriedenheit einige Informationen? Können wir die Situation differenzierter betrachten, aus der Perspektive mehrerer Subjekte? Denken Sie außerdem darüber nach, in welche Richtung wir uns aufgrund dieser Situation weiterentwickeln müssen. Gibt es neue Entdeckungen und Erkenntnisse über uns selbst, andere und das Leben? Was sind Ihre Kernkompetenzen? Welche Schwächen nehmen wieder zu? Welche Werte, Verantwortlichkeiten oder moralischen Standards sind im Laufe der Zeit relevant geblieben und welche haben sich verändert? Wie können all diese Bedeutungen bei uns existieren? Ein häufiger Fehler bei der Bedeutungsgebung besteht darin, zu glauben, es handele sich um eine Lektion, über die man nachdenken müsse, oder um „eine Geschichte, die uns erzählt werden soll“. Das ist nicht der Fall. Bei der Schaffung von Sinn geht es nicht darum, fröhliche Blumen in den Boden des Schmerzes zu pflanzen, und es geht auch nicht unbedingt darum, uns zu lehren, die Realität mit Vorsicht zu betrachten. Das Schaffen von Sinn soll uns lediglich dabei helfen, unser Denken und Fühlen in Bezug auf moralische Dilemmata zu erweitern, sodass wir immer aufrichtig und prinzipientreu handeln und vorankommen können. Verbundenheit: Mit anderen in Verbindung bleiben Mit der Welt in Verbindung zu bleiben, ist eine Tatsache des Lebens. Aktuelle neurowissenschaftliche Forschungen legen nahe, dass unsere Beziehungsbesessenheit fest verdrahtet ist: Wenn wir mit anderen Menschen sprechen, werden Spiegelneuronen in unserem Gehirn aktiviert, um die Emotionen und Verhaltensweisen anderer Menschen nachzuahmen. Matthew Lieberman, Leiter des Labors für Sozial-Kognitive Neurowissenschaften an der University of California in Los Angeles, ist davon überzeugt, dass das menschliche Bedürfnis nach zwischenmenschlichen Beziehungen sogar noch grundlegender ist als Nahrung und Obdach und dass es die wichtigste Antriebskraft für das Verhalten der Menschen darstellt. (newsroom.ucla.edu/releases/we-are-hard-wired-to-be-social-248746) Es ist absolut notwendig, Menschen, denen wir vertrauen, in den Prozess der Entwicklung moralischer Widerstandsfähigkeit einzubeziehen. Beachten Sie hier das Wort „Vertrauen“. das ist der Schlüssel. Wenn wir Herausforderungen, schwierige Emotionen und Frustrationen mit anderen teilen, fühlen wir uns verletzlich. Ein moralisches Dilemma sollte für uns nicht der Anlass sein, unser Terrain bei Menschen zu testen, bei denen wir nicht darauf zählen können, dass sie da sind, zuhören, Empathie zeigen, Mitgefühl ausdrücken, uns aufrichtiges Mitgefühl entgegenbringen und den Samen der Hoffnung in unsere Herzen pflanzen. Das Wissen, dass wir mit unseren moralischen Dilemmas nicht allein sind, kann das Gefühl der Einsamkeit und Verzweiflung erheblich verringern. Wir wollen die Kontrolle am liebsten dann, wenn wir sie nicht haben, und wenn wir uns in einem moralischen Dilemma befinden, kann das wirklich ein Gefühl des Kontrollverlusts sein. Wenn sich unsere Erfahrung von Machtlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit in Richtung einer Welt möglicher, prinzipieller Entscheidungen verschiebt, trägt dies dazu bei, die Auswirkungen moralischer Dilemmata zu mildern und die moralische Belastbarkeit zu fördern. Von Michele DeMarco Übersetzt von Xixi Korrekturlesen/Rabbits leichte Schritte Originalartikel/elemental.medium.com/that-powerlessness-you-feel-is-called-moral-distress-291795756fff Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons-Vereinbarung (BY-NC) und wird von Xixi auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
Artikel empfehlen
Was kann ich tun, wenn ich nach dem Verzehr von Winterdatteln Blähungen bekomme? Was sind die essbaren Werte der Winterjujube
Winterdatteln schmecken frisch köstlich, haben ei...
Diese Krankheit kann nicht von den Eltern vererbt werden, sie sehen grundsätzlich gleich aus! Einfach weil…
Experte dieses Artikels: Dong Xiaoli, Direktor de...
Wie trinkt man weißen Teekuchen richtig? Was für eine Teesorte ist weißer Tee? Schwarzer Tee oder Grüner Tee
Weißer Tee zeichnet sich durch vollständige Knosp...
Bevorzugt Chlorophytum comosum Schatten oder Sonne?
Bevorzugt Chlorophytum comosum Schatten oder Sonn...
Wie wäre es mit der San Miguel Corporation of the Philippines? Philippinen San Miguel Corporation Bewertungen und Website-Informationen
Was ist die Website der San Miguel Corporation of ...
Ist die Taglilie giftig? Wie kann man die Taglilie am sichersten essen?
Taglilien sind ein Gericht, das viele Menschen ge...
Was ist die Verticillium-Welke bei Auberginen? Wie kann man Verticillium-Welke vorbeugen?
Aufgrund des heißen Wetters im Sommer verlieren e...
Im Herbst wird die Haut trocken. Ärzte geben Ihnen einige Tipps zur Feuchtigkeitspflege
Im Herbst ist die Luft trocken und die Haut läuft...
Serie „Gesundheit durch Essen“ | Können Sie „reine Naturnahrung“ ohne Bedenken essen?
Viele Menschen befürchten, dass die Zugabe von Ko...
Verursacht Deqing Tribute Orange innere Hitze? Die Wirksamkeit und Funktion von Deqing Tribute Orange
Die Deqing Tribute Orange ist als „Chinas Orange ...
Die Wirksamkeit und Funktion von Bufona
Bufona, auch als schwarzer Tiger bekannt, ist ein...
Ist Brusthyperplasie eine präkanzeröse Läsion?
Im Allgemeinen entwickelt sich eine Brusthyperpla...
Früh erkennen, frühzeitig behandeln! Dieses Wissen zum Thema „Glaukom“ müssen Sie kennen!
Glaukom ist eine sehr gefährliche Augenerkrankung...
Welttuberkulosetag | Beenden Sie die Tuberkulose-Epidemie und atmen Sie frei und gesund
Anmerkung des Herausgebers: Die Weltgesundheitsor...
Prävention und Behandlung der Alzheimer-Krankheit
1. Wie kann eine gute häusliche Pflege für Patien...