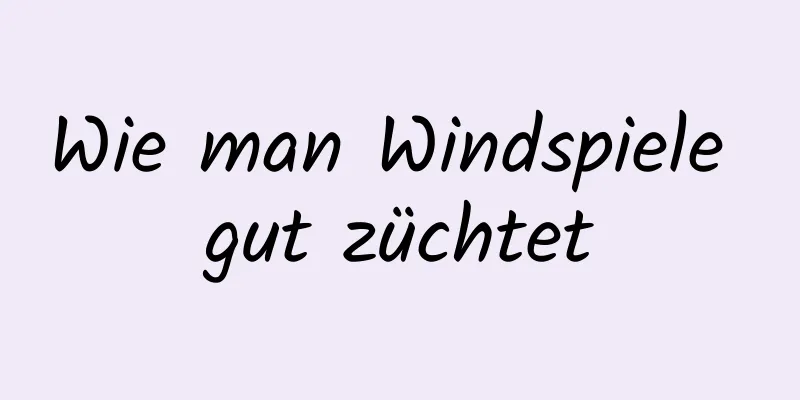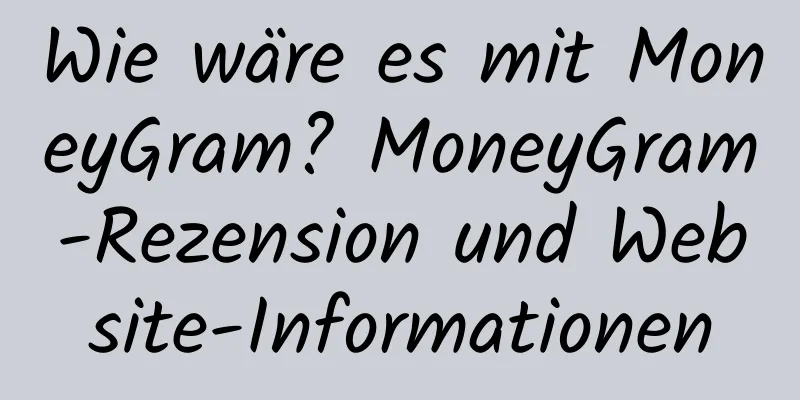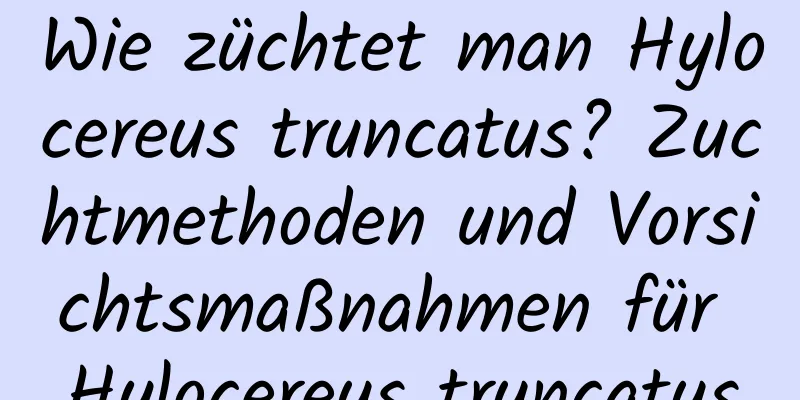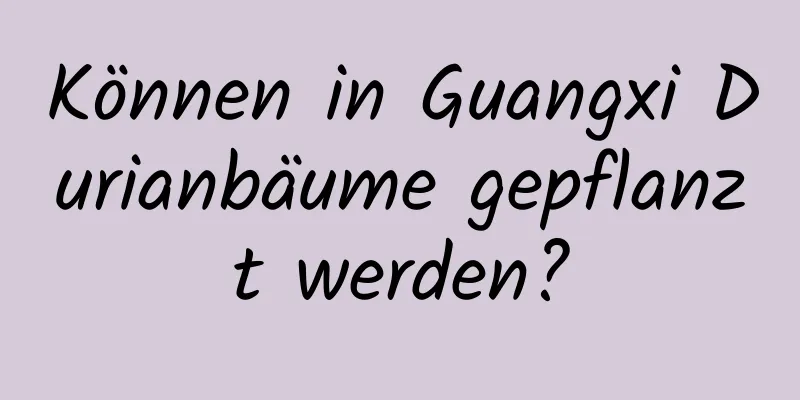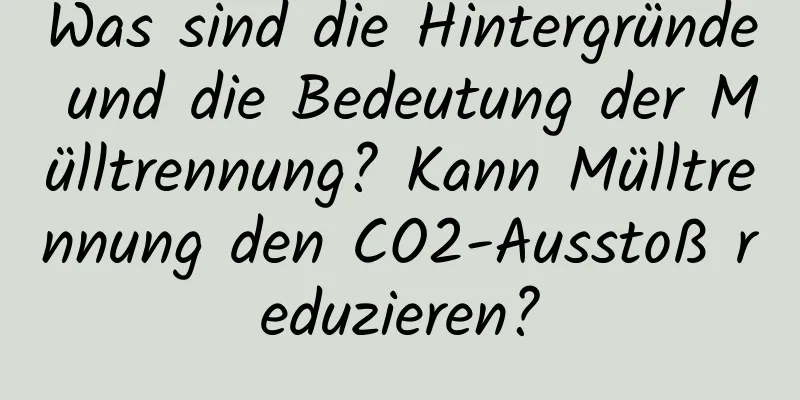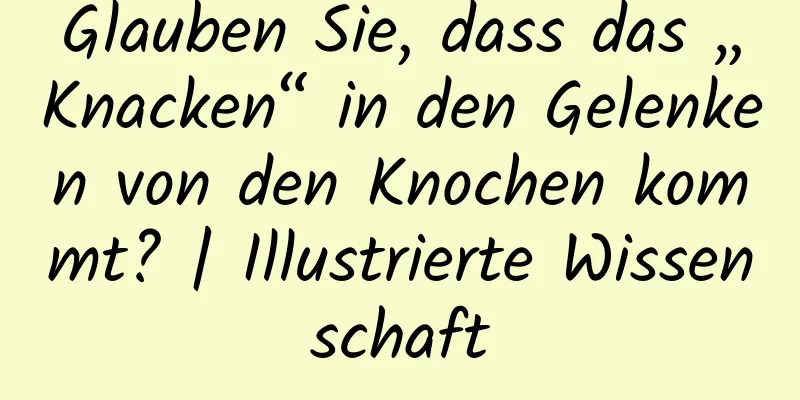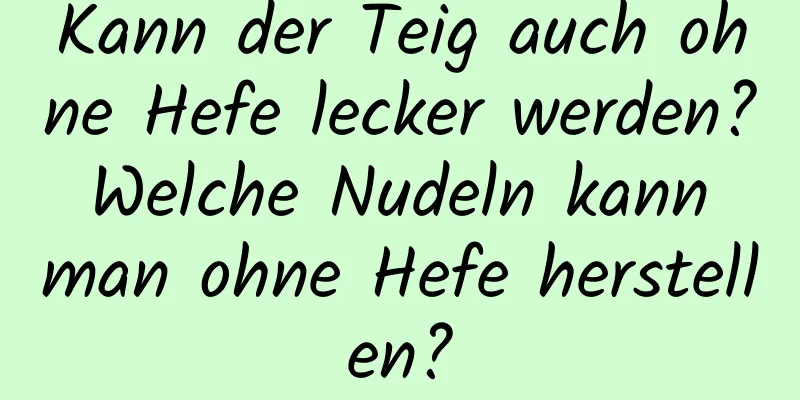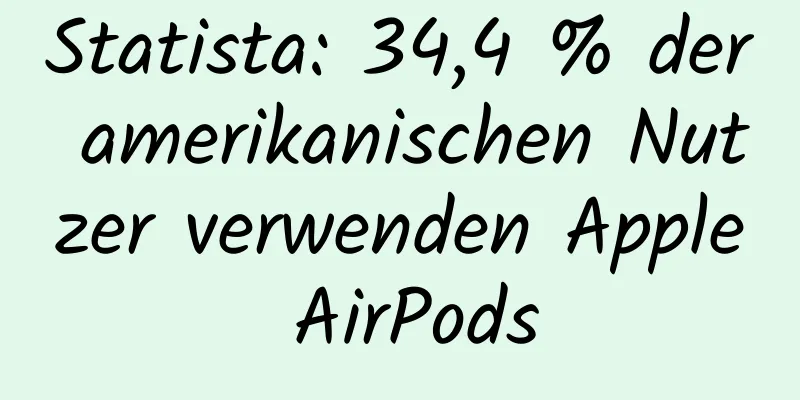Was denken Menschen angesichts von Angst und Armut?
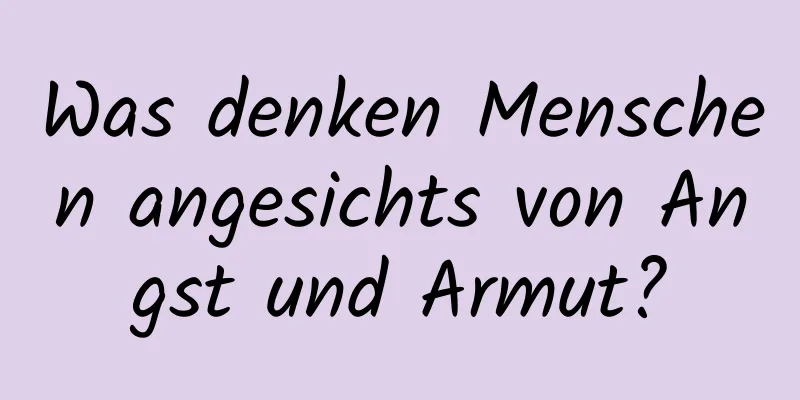
|
Autoren: Tao Rui, Liu Huan, Wei Zihan, Li Minghui (Institut für Psychologie, Chinesische Akademie der Wissenschaften) Der Artikel stammt vom offiziellen Account der Science Academy (ID: kexuedayuan) Anmerkung des Autors Wir glauben normalerweise, dass die subjektiven Gefühle der Menschen in linearem Zusammenhang mit Veränderungen in der objektiven Umgebung stehen. Freiheit von Angst und Freiheit von Not sind zwei grundlegende Freiheiten und hängen mit Veränderungen objektiver Umstände zusammen. Die beiden in diesem Artikel untersuchten, der Intuition widersprechenden Effekte lassen jedoch darauf schließen, dass komplexe psychologische Mechanismen dahinter stecken, wie Menschen mit Umweltveränderungen umgehen und diese beiden Freiheiten verfolgen: Die Entsprechung zwischen der objektiven Umgebung und den subjektiven Gefühlen ist möglicherweise nicht linear. Der erste kontraintuitive Effekt ist der „psychologische Auge des Taifuns“-Effekt, d. h., je näher Sie einem hohen Risiko sind, desto ruhiger werden Sie psychologisch. Der zweite kontraintuitive Effekt ist der „Urban Dislocation“-Effekt. Das heißt, obwohl der objektive Lebensstandard der Stadtbewohner zwischen dem der Stadt- und Landbewohner liegt, ist ihr subjektiver Grad der Wohnverbundenheit nicht zwischen dem der Stadt- und Landbewohner (oder niedriger als dieser). Freiheit von Furcht und Freiheit von Not sind zwei der von Franklin Roosevelt (1941) vorgeschlagenen „grundlegenden menschlichen Freiheiten“ (Abbildung 1). Auch in der Millenniumserklärung der Vereinten Nationen (2009) heißt es eindeutig, dass das Entwicklungsziel der internationalen Gemeinschaft darin besteht, der Menschheit zu helfen, frei von Angst und frei von Armut zu werden. Warum also zählen diese beiden zu den „vier Grundfreiheiten“? Was treibt uns so verzweifelt dazu, für die Freiheit von Angst und Not zu kämpfen? Abbildung 1 Das linke Bild zeigt ein Relief der Vier Freiheiten, das sich am Franklin Delano Roosevelt Memorial in Washington, DC befindet. Das rechte Bild zeigt Franklin Delano Roosevelt, den 32. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Bild aus Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Vier_Freiheiten Umweltveränderungen → psychologische Veränderungen Wenn man genau darüber nachdenkt, ist sein Ursprung eng mit der sich verändernden Umwelt verbunden. Die objektive Umgebung, in der wir leben, verändert sich ständig und wird entweder schlechter oder besser. Einerseits zerstören Naturkatastrophen (wie Erdbeben, Taifune, Überschwemmungen und Tsunamis) unsere objektive Umgebung, das heißt, der Himmel sendet den Menschen Angst, sodass wir nach Freiheit von Angst streben. Um Armut zu vermeiden, verändern Menschen andererseits die Natur künstlich, um die objektive Umwelt zu verbessern. Der Prozess der Industrialisierung und Urbanisierung war für die Menschheit schon immer ein Weg, der Armut zu entkommen und Wohlstand zu erlangen (Abbildung 2). Angesichts von Umweltveränderungen müssen Menschen die Ressourcen ihres Körpers mobilisieren und adaptive Urteile und Reaktionen treffen, um zu überleben. Das ist es, was man „der Geist wird aus der Umgebung geboren“ und „der Geist verändert sich mit der Umgebung“ nennt. Konkret im Kontext von „Naturkatastrophen“ und „Umgestaltung der Natur“ bedeutet es: Freiheit von Angst und Armut. Abbildung 2 Verschiedene Umweltveränderungen, denen Menschen begegnen können: Tsunamis und Erdbeben werden mit Freiheit von Angst in Verbindung gebracht; Urbanisierung und Industrialisierung werden mit der Befreiung von der Armut in Verbindung gebracht. Alle Bilder stammen von Baidu. Angesichts der Herausforderungen und Veränderungen in der Umwelt hat der Mensch zahlreiche Bewältigungs- und Anpassungsmechanismen entwickelt. Wenn wir uns in einer gefährlichen Situation befinden, empfinden wir Angst. wenn wir uns in einer schönen Situation befinden, empfinden wir Freude. Der gesunde Menschenverstand besagt, dass sich subjektive Gefühle linear mit Änderungen der objektiven Umgebung ändern sollten, d. h.: Je gefährlicher die Umgebung (objektiv), desto ängstlicher sollten die Menschen sein (subjektiv). Je besser die Umgebung (objektiv), desto glücklicher sollten die Menschen sein (subjektiv). Nachdem Li Shus Forschungsteam am Institut für Psychologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften über mehrere Jahre hinweg Daten von Zehntausenden von Personen gesammelt hatte, entdeckte es zwei kontraintuitive Effekte. Sie zeigten, dass die sich verändernde Beziehung zwischen subjektiven Gefühlen und objektiver Umgebung nicht unbedingt linear ist. Kontraintuitiver Effekt 1: „Psychologisches Auge des Taifuns“ Angst ist eine natürliche menschliche Reaktion auf verschiedene Umweltgefahren (Soyk, 2011). In der Wissenschaft wird häufig der Begriff „Welleneffekt“ (Slovic, 1987) verwendet, um unsere psychologischen Reaktionen bei schweren Naturkatastrophen wie Erdbeben, Taifunen und Überschwemmungen zu beschreiben. So wie sich Wellen ausbreiten, wird auch die Wirkung unglücklicher Begegnungen mit der Zeit und der Entfernung allmählich schwächer. Im wirklichen Leben ist die Beziehung zwischen objektiver Gefahr und subjektiver Angst jedoch anders. Im Mai 2008 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 8,0 Wenchuan. Li Shu und andere führten eine groß angelegte Umfrage unter Bewohnern in Nicht-Katastrophengebieten (542 Personen in Beijing, Fujian und Hunan) und Katastrophengebieten (1.720 Personen in Sichuan und Gansu) durch. Die Umfrage ergab überraschenderweise, dass die Bewohner umso ruhiger waren, je näher sie dem Epizentrum wohnten. Das heißt, mit zunehmender Schwere der Katastrophe in ihrer Region (von nicht betroffen, leicht betroffen, mäßig betroffen bis schwer betroffen) schätzten die Bewohner, dass der Bedarf an Ärzten und psychologischem Personal im Katastrophengebiet, die Möglichkeit einer großflächigen Ausbreitung einer Infektionskrankheit im Katastrophengebiet und die Zahl der zu ergreifenden Erdbebenvermeidungsmaßnahmen abnahmen (Abbildung 3; Li et al., 2009). Abbildung 3 Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Besorgnis über Sicherheits- und Gesundheitsprobleme nach dem Erdbeben und dem Ausmaß der Schäden am Wohngebäude Der Forscher Li Shu nannte diesen Effekt den „psychologischen Taifun-Augen“-Effekt (Abbildung 4), d. h. in der Zeitdimension ist der Geist umso ruhiger, je näher die Hochrisikoperiode rückt. In der räumlichen Dimension gilt: Je näher am Hochrisikobereich, desto ruhiger ist der Geist. Abbildung 4 Taifunauge: Da die Heimatstadt des Forschers Li Shu, Fujian, anfällig für Taifunereignisse ist, nannte er diesen Effekt absichtlich „psychologisches Taifunauge“. Das Bild stammt von Baidu. (Anmerkung der Redaktion: Der kreisförmige Bereich mit einem Durchmesser von etwa 10 Kilometern rund um das Zentrum des Taifuns wird in der Meteorologie üblicherweise als „Auge des Taifuns“ bezeichnet. Die Luft darin rotiert kaum und der Wind ist vergleichsweise schwach.) Zwei Varianten Variante 1: Die Beziehungsversion des „psychologischen Auges des Taifuns“-Effekts: Vier und elf Monate nach dem Erdbeben in Wenchuan führten Li Shu und seine Kollegen zwei Nachuntersuchungen an 4.178 Bewohnern des Katastrophengebiets (Sichuan und Gansu) und 1.038 Bewohnern in Nicht-Katastrophengebieten (Peking und Fujian) durch. Diese beiden Folgestudien ergaben, dass der Effekt des „psychologischen Taifunauges“ ein Jahr nach dem Erdbeben von Wenchuan immer noch stark war. Gleichzeitig stellten sie auch eine Variante des „psychologischen Auges des Taifuns“-Effekts fest – die relationale Version des „psychologischen Auges des Taifuns“-Effekts. Das heißt: Je enger die Verwandtschaft mit den Opfern, die Sachschäden erlitten haben, oder je enger die Verwandtschaft mit den Opfern, die lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben, desto geringer sind die Sorgen der Bewohner hinsichtlich ihrer Gesundheit und Sicherheit. Variante 2: Der „Psychologische Auge des Taifuns“-Effekt der Beteiligung: Zheng Rui et al. (2015) führten eine Haushaltsbefragung unter Bewohnern eines Blei- und Zinkbergbaugebiets im Kreis Fenghuang, Xiangxi, durch (217 Dorfbewohner im Bergbaugebiet). In dieser Studie wurde die Beziehung zwischen der Beteiligung der Dorfbewohner an der Bergbaukrise und ihrer Risikowahrnehmung untersucht. Dabei wird die Beteiligung am Bergbau in vier Kategorien unterteilt, je nach dem unterschiedlichen Grad der Beteiligung der Dorfbewohner am Bergbau, von hoch bis niedrig: Minenbesitzer (Dorfbewohner, deren eigenes Land Erz produzieren kann), Bergleute (Dorfbewohner, die in kleinen Minen arbeiten), Familien von Minenbesitzern und Bergleuten und Dorfbewohner, die nicht am Bergbau beteiligt sind. Es liegt auf der Hand, dass das Risikobewusstsein einer Person umso höher sein sollte, je häufiger sie an riskanten Ereignissen beteiligt ist. Die Umfrageergebnisse zeigen jedoch, dass das Risikobewusstsein sowohl bei den Minenbesitzern als auch bei den Dorfbewohnern, die nicht im Bergbau tätig sind, allmählich zunimmt, was auf einen offensichtlichen „psychologischen Auge des Taifuns“-Effekt hindeutet. Forscher bezeichnen dies als die Involvierungsversion des „psychologischen Auges des Taifuns“-Effekts. Das heißt: Je höher der Grad der Involvierung in Risikoereignisse, desto geringer ist das Risikobewusstsein (Abbildung 5). Abbildung 5: Durchschnittliches Risikobewusstsein der Dorfbewohner im Kreis Fenghuang (höhere Werte bedeuten ein höheres Risikobewusstsein) Soziale Auswirkungen Der Effekt des „psychologischen Auges des Taifuns“ zeigt, dass die subjektive Angst nicht monoton mit der Zunahme der objektiven Gefahr zunimmt. Die Entdeckung des „psychologischen Taifun-Augen“-Effekts hat auch die Aufmerksamkeit von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten auf sich gezogen: Noah Gray (2010), leitender Redakteur von Nature, ist der Ansicht, dass dieses Ergebnis „für politische Entscheidungsträger sehr wichtig ist, da es ihnen hilft, bessere Maßnahmen zur Reaktion auf Gesundheitsrisiken zu formulieren. Denn es hilft uns, besser zu verstehen, wer unter der Katastrophe leidet.“ Die Washington Post veröffentlichte einen ausführlichen Bericht über die Forschung zu den Auswirkungen des „psychologischen Auges des Taifuns“ auf die Risiken der Umweltverschmutzung mit dem Titel „Das große Paradox der menschlichen Wahrnehmung von Umweltrisiken“. Der Bericht ist der Ansicht, dass die Entdeckung des Effekts des „psychologischen Auges des Taifuns“ eindeutig belegt, dass sich die psychologische Wahrnehmung der Öffentlichkeit nicht allein durch die Präsentation von Daten und statistischen Ergebnissen ändern lässt und dass politische Entscheidungsträger bei der Lösung von Umweltproblemen stärker mit der Öffentlichkeit kommunizieren und interagieren sollten (Harvey, 2015). Kontraintuitiver Effekt 2: „Stadtverlagerung“ Seit der Reform und Öffnung hat China ein enormes Wirtschaftswachstum und eine schnelle Urbanisierung erlebt. Bis Ende 2014 hatte Chinas Urbanisierungsrate 54,77 % erreicht und lag damit über dem weltweiten Durchschnitt von 53 % (National Bureau of Statistics, 2013). Wir haben offenbar Grund zu der Annahme, dass schnelles Wirtschaftswachstum und schnelle Urbanisierung das subjektive Wohlbefinden der Bewohner erheblich steigern werden. Allerdings haben Forscher herausgefunden, dass in einigen Industrieländern – darunter den USA, Japan, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und den Niederlanden – das durchschnittliche subjektive Wohlbefinden praktisch unverändert geblieben ist, obwohl das Pro-Kopf-Einkommen im letzten Jahrzehnt weiter gestiegen ist (z. B. Blanchflower und Oswald, 2004; Easterlin und Sawangfa, 2010). Diese Ergebnisse implizieren, dass die subjektiven Wahrnehmungen nicht linear mit dem Urbanisierungsgrad variieren. Existiert dieser nichtlineare Zusammenhang auch in Entwicklungsländern wie China? Wang et al. (2015) führte von August bis September 2007 eine Haushaltsbefragung unter Einwohnern (insgesamt 3716 Personen) in drei Regionentypen (ländlich, städtisch und urban) in unterschiedlichen Stadien der Urbanisierung im ganzen Land durch. Die Forscher untersuchten die subjektiven Ansichten der Menschen über ihren Wohnort durch direkte und indirekte Messungen. Der subjektive Indikator, der direkt gemessen wird, ist die Selbsteinschätzung des sozialen Umfelds, also ob die Bewohner glauben, dass ihr Wohnort ein harmonisches und schönes soziales Umfeld bietet. Der indirekte subjektive Indikator (Ortsverbundenheit) wurde mit einem projektiven Test gemessen (Li, 2016), bei dem die Bewohner nicht direkt nach ihrer Einstellung zu ihrem Wohnort gefragt werden, sondern von ihnen verlangt wird, Entscheidungen über Angelegenheiten zu treffen, die für sie von großer Bedeutung sind. Dazu gehört die Frage, ob sie bereit sind, einen Einheimischen als Lebenspartner zu wählen, ob sie bereit sind, im nächsten Leben in der Gegend wiedergeboren zu werden, ob sie möchten, dass ihre Kinder den lokalen Dialekt beherrschen und ob sie emotional darauf reagieren, wenn Außenstehende Einheimische beleidigen (Wang et al., 2015). Menschen mit einer starken Wohnortbindung sind eher bereit, Einheimische als Partner zu wählen, im nächsten Leben Einheimische zu sein, ihren Kindern den lokalen Dialekt beizubringen und starke emotionale Reaktionen auf beleidigende Worte von Außenstehenden über Einheimische zu zeigen. Objektiven Indikatoren zufolge (wie der Sterberate von Kindern unter fünf Jahren, der Analphabetenrate unter Erwachsenen und dem durchschnittlichen monatlichen Haushaltseinkommen usw.) zeigt sich mit zunehmendem Urbanisierungsgrad ein Aufwärtstrend bei der Lebensqualität der Bewohner vom Land in die Stadt. Logischerweise sollte auch der Grad der Wohnbindung der Bewohner eine ähnliche Entwicklung aufweisen, d. h. der Grad der Wohnbindung der Stadtbewohner sollte zwischen dem der Land- und Stadtbewohner liegen. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass die Wohnbindung und die selbstbewerteten Werte für das soziale Umfeld der Stadtbewohner geringer sind als die der Land- und Stadtbewohner (Abbildung 6; Wang et al., 2015). Abbildung 6 Durchschnittliche „Wohnortverbundenheit“ der Land-, Stadt- und Stadtbewohner (je höher der Wert, desto stärker ist die Verbundenheit mit der Region) Angesichts dieser „unlogischen“ Natur haben Wang et al. (2015) nannten diese V-förmige Beziehung den „Stadtverlagerungseffekt“. Der Effekt der „Urban Dislocation“ beschreibt die asynchronen Veränderungen der subjektiven Wahrnehmung und der objektiven Umgebung während des Urbanisierungsprozesses. Obwohl der Effekt der „städtischen Verlagerung“ unerwartet ist, ist er dennoch angemessen. Eine ähnliche Geschichte wird in Äsops Fabeln erzählt: Die Landmaus beneidete die Stadtmaus um leckeren Kuchen und Bier und zog deshalb in die Stadt. Nachdem sie jedoch den großen Unterschied zwischen Stadt und Land am eigenen Leib erfahren hatte, dachte die Landmaus, dass es besser wäre, aufs Land zurückzukehren und ein friedliches Leben zu führen, anstatt in der Stadt mit Anspannung und Angst zu leben und köstliches Essen zu genießen. Genau wie Mäuse auf dem Land scheinen Menschen einen ähnlichen „Hirtenkomplex“ zu entwickeln, wenn sie mit Städten konfrontiert werden (Wang et al., 2015). Die beiden oben erwähnten, kontraintuitiven Effekte legen nahe, dass die Beziehung zwischen subjektiven Gefühlen und Veränderungen in der objektiven Umgebung möglicherweise nicht linear ist. Hinter der Reaktion der Menschen auf Umweltveränderungen und ihrem Kampf um Freiheit von Angst und Armut stecken komplexe psychologische Mechanismen. Je mehr Menschen „Freiheit von Angst und Not“ als eine grundlegende Freiheit betrachten, desto mehr Verantwortung tragen Psychologen, zwischen dem psychologischen Abwehrmechanismus der „Freiheit von Angst“ und dem psychologischen Anpassungsmechanismus der „Freiheit von Not“ zu unterscheiden. Da diese Mechanismen noch immer unbekannt sind, wird die Menschheit weiterhin nach Freiheit streben. Quellen: [1]Li, S., Rao, LL., Bai, [2]Li, S., Rao, LL., Bai, [3]Wang, F., Li, S., Bai, XW., Ren, XP., Rao, LL., Li, JZ., ... [4]Wei, ZH, Tao, R., Liu, H. & Li, S. (2017). „Freiheit von Angst und Not“ und unsere psychologische Reaktion auf Umweltveränderungen. Zeitschrift für Pazifikraumpsychologie, 11. |
Artikel empfehlen
Welche Vorteile hat der Verzehr von Wachskürbis? Welche Suppe passt gut zu Wintermelone?
Das in Wachskürbis enthaltene Carotin kann nicht ...
Welcher Dünger für Erdnüsse
Durch das Düngen von Erdnüssen können die Erdnuss...
Für wen ist Kurkuma geeignet? Unter welchen Umständen sollte Kurkuma nicht gegessen werden?
Kurkuma ist eine häufige Nahrungsmittelzutat. Es ...
Wie man Drachenbart-Orchideen züchtet und beschneidet
Die Drachenbartorchidee ist eine dekorative Blume...
Zutaten und Zubereitung für Weißdornmarmelade
Weißdornmarmelade ist in unserem täglichen Leben ...
Blüten- und Fruchtabfall bei Tomaten und dessen Vorbeugung und Bekämpfung
Wenn bei Tomaten Blüten und Früchte abfallen, wir...
Wenn Sie nach dem Trinken von Milch Durchfall bekommen, finden Sie hier 4 Tipps, die Ihnen dabei helfen, das Problem zu lösen!
Milch ist ein wichtiges Getränk zur täglichen Kal...
Anbaumethoden und Vorsichtsmaßnahmen für südamerikanische Narzissen (Tipps zur Pflege südamerikanischer Narzissen)
Die südamerikanische Narzisse ist auch als Amazon...
Der alte Mann hatte Kopfschmerzen und dachte, es sei eine zervikale Spondylose, aber es stellte sich heraus, dass es ein Glaukom war
Oma Sun hatte Kopfschmerzen und dachte zunächst, ...
Zuckerrohr-Birnen-Porridge
Zuckerrohr-Birnen-Brei ist eine Art Brei, der aus...
Bilder von kleinen Melonen Nährwert und Verzehrmethoden von kleinen Melonen
Kleine Melonen können kalt oder gebraten gegessen...
Medizinischer Wert und Wirksamkeit von Kakteen
Kakteen sind die beliebtesten Grünpflanzen. Sie k...
Können Massagen und Akupunktur einen Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule heilen?
Bei einem Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbel...
So reifen Sie Durian So reifen Sie Durian
Durian ist eine tropische Frucht mit einem besond...
Können Erdbeeren in Töpfen angebaut werden?
Können Erdbeeren in Blumentöpfe gepflanzt werden?...