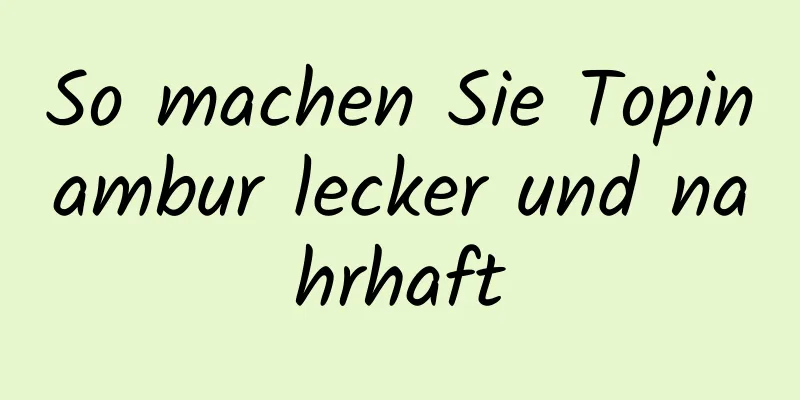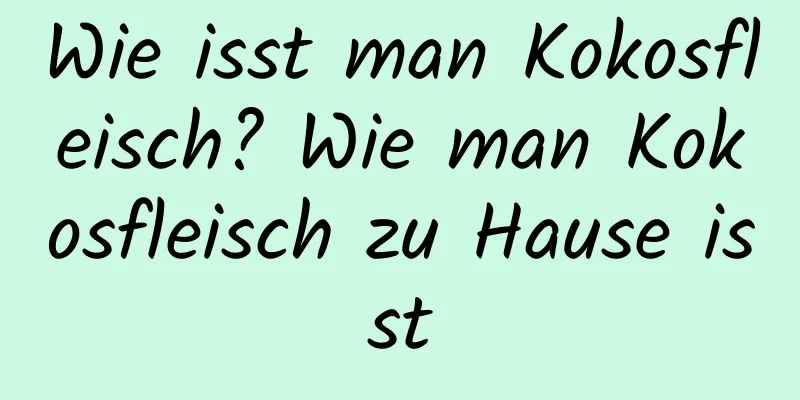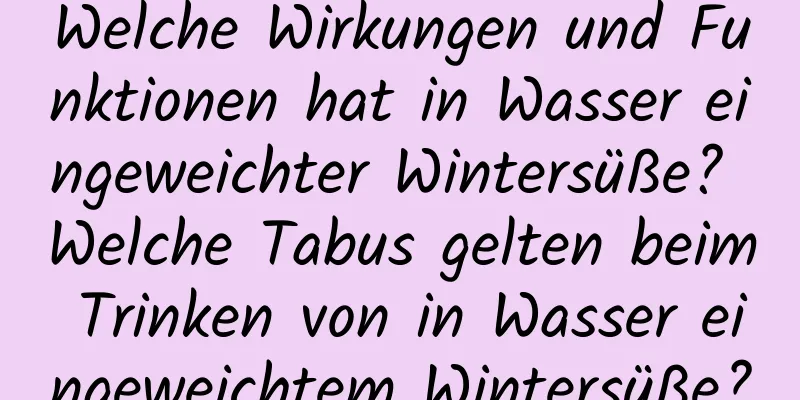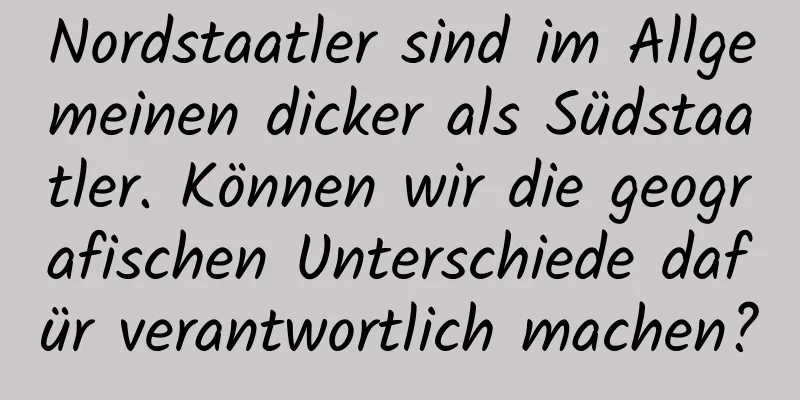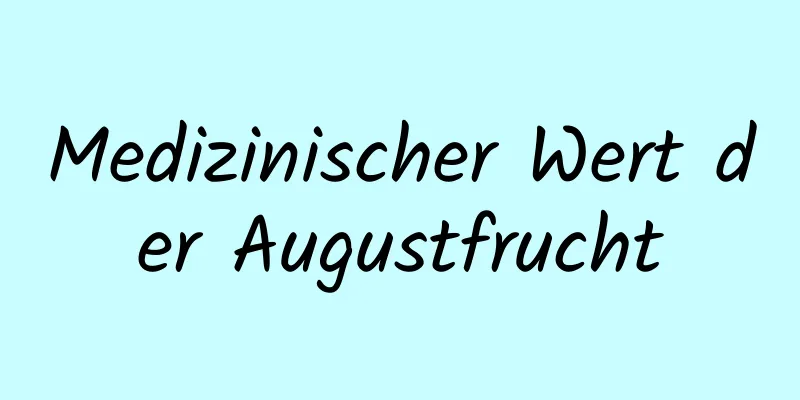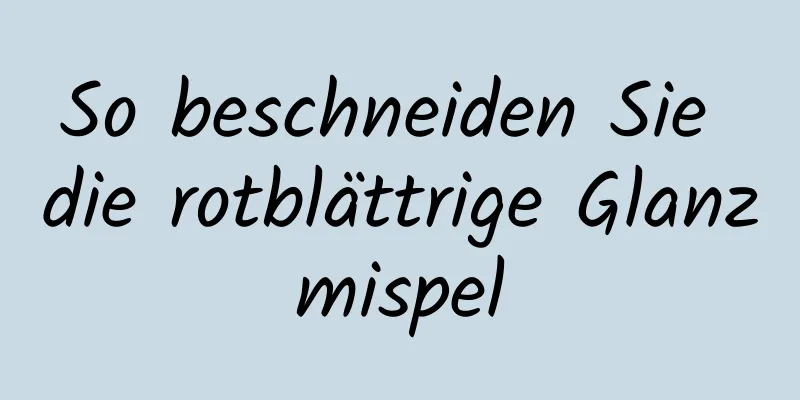Die Post-90er-Generation schreibt Lehrbücher neu! Neues Verständnis der Funktion menschlicher Gehirnproteine
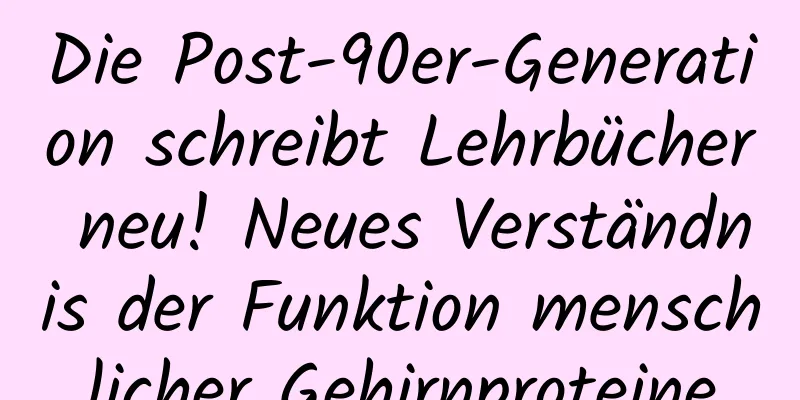
|
Als Sun Chao den Ablehnungsbescheid in seinem Briefkasten sah, war er für einige Sekunden fassungslos. Dies ist ein Ablehnungsschreiben von Science. Im Anhang lobten drei Gutachter einhellig: „Dies ist eine erstaunliche Studie, und es ist absehbar, dass sie nach ihrer Veröffentlichung weitreichende Auswirkungen haben wird.“ Die Redaktion folgte der Meinung der Gutachter jedoch nicht und kam stattdessen zu dem Schluss, dass der Artikel nicht zur Veröffentlichung freigegeben werden sollte. Angesichts diametral entgegengesetzter Ansichten schrieb Sun Chaos Team eine zweite E-Mail und bat die Redaktion des Magazins um die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen. Diesmal war die Redaktion einverstanden. Nach nur einer Überarbeitung und Begutachtung gelang es, diese abgelehnte Forschung im Mai dieses Jahres mit „wundersamer Geschwindigkeit“ zu veröffentlichen. Dies ist auch das erste Mal, dass der 32-jährige Sun Chao als Erstautor einen Artikel in Science veröffentlicht hat. „Wenn Sie bei der Abgabe einer Arbeit noch eine Frage stellen, gibt es vielleicht einen Wendepunkt.“ Sun Chao, der jetzt unabhängiger PI am Institute of Translational Neuroscience der Universität Aarhus in Dänemark ist, sagte dies bewegt. Sun Chao veröffentlichte als Erstautor einen Science-Artikel Eine Entdeckung, die „die Lehrbücher neu schreibt“ Diese in Science veröffentlichte Forschungsarbeit stammt vom Institut für Hirnforschung der berühmten „Nobelpreisfabrik“ – dem Max-Planck-Institut (MPI) in Deutschland. Das Gehirn ist der am weitesten entwickelte Teil des menschlichen Nervensystems und zugleich das komplexeste und ausgefeilteste Instrument. Sun Chaos Forschungsobjekt ist der unscheinbarste „Putzsoldat“ im Betriebssystem des Gehirns – das Proteasom. Das menschliche Gehirn verfügt über mehr als 100 Billionen Synapsen. Diese synaptischen Verbindungen definieren neuronale Schaltkreise und speichern Informationen während des gesamten Lebens. Die durchschnittliche Haltbarkeitsdauer von Proteinen, den wichtigsten Funktionsmolekülen in Synapsen, beträgt jedoch nur eine Woche. Für die „Müllentsorgung“ alter Proteine ist der „Putzsoldat“ Proteasom zuständig. Es wird allgemein angenommen, dass das Proteasom aus zwei Komplexen besteht, 19S und 20S, die paarweise auftreten und gleichzeitig arbeiten: Ersterer ist für die „Steuerung“ und Erkennung alter Proteine verantwortlich; Letzterer ist für die „Ausführung“ und den Abbau alter Proteine zuständig. Das Team des Max-Planck-Instituts, bei dem Sun Chao während seiner Postdoc-Zeit arbeitete, fand jedoch heraus, dass die beiden Proteasomkomponenten in den Synapsen des Gehirns nicht eins zu eins korrespondieren, dass der 19S-Regulationskomplex doppelt so zahlreich ist wie der 20S-Regulationskomplex und dass 70 % der 19S-Regulationskomplexe in einem freien, unabhängigen Zustand vorliegen. Wichtig ist, dass der freie 19S-Regulationskomplex mit vielen synaptischen Proteinen zu interagieren scheint, einschließlich jener, die an der Freisetzung und Erkennung von Neurotransmittern beteiligt sind, und so die Informationsübertragung und -speicherung an Synapsen reguliert. Dies bedeutet, dass sich komplexe Proteinmaschinen möglicherweise an subzelluläre Bedürfnisse angepasst haben und „Mondlicht“ nutzen, um alternative Funktionen zu übernehmen. Diese Forschung hat unser Verständnis der Funktion synaptischer Proteine auf ein neues Niveau gehoben und wird bei der Behandlung neurologischer Erkrankungen, die durch synaptische Funktionsstörungen verursacht werden, wie etwa Parkinson und Alzheimer, hilfreicher sein. Man kann sagen, dass dies eine Entdeckung ist, die Lehrbücher neu schreibt. „Wir sind von unserer Arbeit sehr überzeugt und waren daher eher verwirrt als enttäuscht, als wir den Ablehnungsbescheid erhielten.“ Sun Chao spekulierte, dass diese Forschung, wie die Gutachter kommentiert hatten, möglicherweise weitreichende Auswirkungen haben würde, sodass die Redaktion von Science das Manuskript direkt abgelehnt habe, als nicht genügend Zeit blieb, um das Experiment abzuschließen. Als Autor ist sich Sun Chao der natürlichen Ungleichheit zwischen ihm und den Top-Zeitschriften durchaus bewusst. Er sagte: „Für Spitzenzeitschriften wie Nature und Science ist es kein großer Verlust, wenn versehentlich ein Artikel verpasst wird. Für die Autoren ist es jedoch eine wichtige Chance, für die gekämpft werden muss.“ Finden Sie den richtigen Hammer, um den Nagel zu treffen Sun Chao sagte, dass die größte Schwierigkeit bei der Forschung im biologischen Bereich darin bestehe, sowohl den „Hammer“ als auch den „Nagel“ zu haben, also die Methoden und Probleme anzupassen. Er verwendete eine Analogie: „Ein Wissenschaftler, der methodische Forschung betreibt, ist so, als ob er einen Hammer in der Hand hält, aber nicht weiß, auf welchen Nagel er schlagen soll; ein Wissenschaftler, der biologische Forschung betreibt, ist so, als ob er den Nagel sucht, aber nicht weiß, welchen Hammer er benutzen soll.“ Am Beispiel dieser jüngsten in Science veröffentlichten Studie lässt sich feststellen, dass es in der Vergangenheit nur wenige Studien zum Phänomen des „Teilzeitjobs“ des Proteasoms gab. Der Grund dafür ist, dass diese „Putzsoldaten“ zu klein sind, um mit herkömmlichen Methoden beobachtet zu werden. Wenn es eine Beobachtungstechnologie gäbe, die eine nahezu unendliche Vergrößerung erreichen könnte, könnten wir deutlich erkennen, dass das Gehirn zig Milliarden Nervenzellen enthält, auf jeder Nervenzelle Hunderte von Synapsen, auf jeder Synapse Hunderte oder Tausende von Proteinen und dass die „Reinigungssoldaten“ 19S- und 20S-Proteasomen zwischen diesen Proteinen hin- und herpendeln. Diese magische Technologie ist genau der „Hammer“, den Sun Chao in dieser Forschung verwendet hat – die DNA-PAINT-Bildgebungstechnologie. Diese vom Max-Planck-Institut für Biochemie entwickelte Technologie ist eine Erweiterung der superauflösenden Fluoreszenzmikroskopie. Anstatt Proteine durch herkömmliche fluoreszierende Moleküle zu identifizieren, werden Protein-DNA-Sequenzen direkt markiert, um hochauflösende Bilder mit Nanometerauflösung zu erhalten. Im Jahr 2014 wurde die Fluoreszenzmikroskopie mit superhoher Auflösung mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung in diesem Jahr riss sich Sven Lidin, der damalige Vorsitzende des Nobelpreiskomitees für Chemie, eine Haarsträhne aus, um allen diesen Durchbruch zu erklären. Der Durchmesser eines menschlichen Haares beträgt etwa 100 Mikrometer und ist mit einem herkömmlichen optischen Mikroskop leicht zu erkennen. Der Durchmesser eines Bakteriums beträgt jedoch nur etwa 200 Nanometer und überschreitet damit die Grenzen eines herkömmlichen optischen Mikroskops. Die von drei Wissenschaftlern, darunter Professor Stefan W. Hell vom Max-Planck-Institut, entwickelte Technologie der superauflösenden Fluoreszenzmikroskopie hat die Grenzen herkömmlicher optischer Mikroskope durchbrochen und die Beobachtung der mikroskopischen Welt in das Nanozeitalter gebracht. „Wenn die technische Hürde einer Forschung relativ hoch ist, ist das Risiko, zuvorzukommen, relativ gering“, schloss Sun Chao. Sein Team brauchte neun Jahre von der ersten Anwendung der DNA-PAINT-Bildgebungstechnologie bis zur Veröffentlichung der Beobachtungsergebnisse in Science. Wenn die „Nägel“ der Biologen und die „Hämmer“ der Methodologen ihre Kräfte bündeln, führt das zu mehr Effizienz? Theoretisch stimmt das, in der Praxis ist eine solche Zusammenarbeit jedoch schwer zu erreichen. Sun Chao erklärte: „Verschiedene Arbeitsfelder haben unterschiedliche Anliegen, und es ist schwierig, ein Forschungsproblem zu finden, das den gemeinsamen Interessen von Methodologen und Biologen entspricht.“ „Für einen Biologen ist es wichtiger, ein Forschungsproblem zu finden, das ihn interessiert, und dann eine geeignete Methode zu finden, um es zu lösen.“ Nach Ansicht von Erin Schuman, der korrespondierenden Autorin dieser Studie, Gründerin und Direktorin des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung, ist die Logik, „den richtigen Nagel zu finden, um einen Hammer zu machen“, eher für Biologen geeignet. Im März dieses Jahres gewann Erin den Brain Prize, den Nobelpreis der Neurowissenschaften, der zugleich eine der höchsten Auszeichnungen auf diesem Gebiet ist. Als Antwort auf seit langem bestehende Fragen hat das Labor von Erin Schuman neue Werkzeuge, die BONCAT- und FUNCAT-Technologien, entwickelt, die die Markierung, Reinigung, Identifizierung und Visualisierung neu synthetisierter Proteine in Neuronen und anderen Zellen ermöglichen. „Vielleicht verstehst du diese Methode im Moment noch nicht, aber du musst sie lernen, beherrschen oder den richtigen Helfer finden, bis du das Problem lösen kannst.“ Erin fügte hinzu: „Noch wichtiger ist: Lassen Sie sich bei Ihrer Vorstellungskraft hinsichtlich eines Problems nicht durch die vorhandene Technologie einschränken.“ Ein Hoch auf den Neuanfang „Prost! Wir haben unsere Arbeit endlich eingereicht und das war der krönende Abschluss.“ Nach jeder Einreichung lud Direktor Erin Schuman die Labormitglieder auf eigene Kosten zu einem Getränk ein. Dies ist am Max-Planck-Institut für Hirnforschung mittlerweile zur Tradition geworden. Erin trinkt am liebsten starken Alkohol. Um die angespannten Nerven während der Recherche zu entspannen, genügt bereits ein Glas 40-50 Grad Tequila. Als der letzte Artikel veröffentlicht wurde, lud Erin das Team zur Feier in ein Sichuan-Restaurant in Frankfurt ein. Da es im Restaurant keinen Schnaps gab, musste stattdessen Bier verwendet werden. Im vergangenen August reichte Sun Chaos Team einen Artikel bei Science ein. Als Sun Chao zum Feiern sein Glas erhob, ahnte er bereits die bevorstehende Trennung: Dies war seine letzte Forschungsarbeit am Max-Planck-Institut, und mit der Einreichung der Arbeit neigte sich seine fünfjährige Postdoc-Karriere dem Ende zu. Im März dieses Jahres begann Sun Chao offiziell die PI-Phase an der Universität Aarhus in Dänemark. „Es ist, als ob Sie Ihren Führerschein machen und dann alleine auf die Straße gehen müssen.“ Als er seine Arbeit aufnahm, war Sun Chao damit beschäftigt, sich mit der neuen Umgebung vertraut zu machen und ein Labor einzurichten. Er konnte längere Zeit keine Experimente durchführen oder mit Daten umgehen. Er lachte und sagte, er habe „das Gefühl, einen völlig anderen Job zu machen“. Das Institut für Translationale Neurowissenschaften an der Universität Aarhus, an dem Sun Chao arbeitet, blickt auf eine lange Tradition neurowissenschaftlicher Forschung zurück. 1997 erhielt der Biochemiker Jens Christian Skou von der Universität Aarhus den Nobelpreis für Chemie für die Entdeckung der „Natriumpumpe“. Für Sun Chao ist die großzügige Finanzierung ein weiterer Anreiz der Universität Aarhus. Die biologische Forschung stellt sehr hohe Anforderungen an Instrumente und Geräte. Ein Abbelight SAFe 360-Fluoreszenzmikroskop mit Superauflösung hat einen Wert von 4 Millionen RMB. Am Institute of Translational Neuroscience verfügte Sun Chao über ein Startkapital von mehr als 10 Millionen RMB, sodass die Rekrutierung von Personal kein Problem darstellte. Bei der Anwerbung von Partnern legt Sun Chao größten Wert auf die Eigeninitiative der Forscher: „Ich möchte im Labor eine freie wissenschaftliche Forschungsatmosphäre schaffen, in der die Teammitglieder die Initiative ergreifen können, um interessante Forschungsprobleme zu finden und ihre Zeit und Energie selbstständig einzuteilen. Auch chinesische Doktoranden und Postdoktoranden sind herzlich eingeladen, in meinem Labor zu arbeiten.“ Dieses Konzept deckt sich mit dem vom Max-Planck-Institut vertretenen „Harnack-Prinzip“. Dieses Prinzip wurde von Adolph von Harnack, dem ersten Präsidenten der 1911 gegründeten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, dem Vorgänger des Max-Planck-Instituts, vorgeschlagen und wird seit mehr als hundert Jahren erfolgreich angewendet. Der Kern des Programms ist auf den Menschen ausgerichtet, sodass die besten Kandidaten ihre Forschungsthemen selbstständig auswählen und die Forschungsressourcen frei nutzen können. Heute kommt Sun Chaos neues Labor allmählich auf die Beine. Auch dieser 32-jährige junge PI hat eine neue Phase der wissenschaftlichen Forschung erreicht. „Abschied bedeutet Neuanfang“, zitierte er einst Eliots Gedicht in den sozialen Medien: „Wir werden weiter forschen, und am Ende unserer Erkundung werden wir an dem Ort ankommen, von dem wir aufgebrochen sind.“ |
>>: Das Geheimnis der Blutreinigung: Wie erhält man die Nierenfunktion?
Artikel empfehlen
Wie viel wissen Sie über „großen Hals“?
Dies ist der 3536. Artikel von Da Yi Xiao Hu „Ein...
Pfefferbrei
Ich frage mich, ob Sie alle etwas über Pfefferbre...
Wie wäre es mit den Edmonton Oilers? Edmonton Oilers-Rezensionen und Website-Informationen
Was ist die Website der Edmonton Oilers? Die Edmon...
So beschneiden Sie Apfelbäume
Wann sollte man Apfelbäume beschneiden? Apfelbäum...
Wie lange ist Make-up haltbar? So verwenden Sie Make-up
Make-up ist heutzutage eine sehr beliebte Schmink...
Nährwert und Wirksamkeit von schwarzen Bohnen
Jeder hat ein gewisses Verständnis von schwarzen ...
Auf der Oberfläche der Biskuitrolle befinden sich viele kleine Bläschen. Warum ist die Oberfläche der Biskuitrolle nicht glatt und eben?
Wir alle wissen, dass Biskuitrollen ein reichhalt...
Wie isst man getrocknete Schwertblumen und welche Vorteile bietet der Verzehr von getrockneten Schwertblumen?
Die Schwertblume, auch Königsblume genannt, ist e...
Wie wäre es mit der Avis Budget Group? Avis Budget Group Bewertungen und Website-Informationen
Was ist die Avis Budget Group? Die Avis Budget Gro...
Wird Tee bei hohen Temperaturen schlecht? Wie kann Tee viele Jahre lang aufbewahrt werden, ohne dass er verdirbt?
Mit der Verbesserung des Lebensstandards haben si...
Wann ist der beste Zeitpunkt, Flachs auszusäen?
Aussaatzeit für Flachs Flachs ist eine Pflanze au...
Welche Vorteile hat Trinkwasser?
Wir hören oft, wie Erwachsene zu Kindern oder ält...
Magenschmerzen müssen nicht unbedingt vom Magen verursacht werden!
In unserer klinischen Arbeit begegnen wir häufig ...
Können Alpenveilchen hydroponisch angebaut werden? Ist Hydrokultur oder Bodenanbau besser?
Können Alpenveilchen hydroponisch angebaut werden...